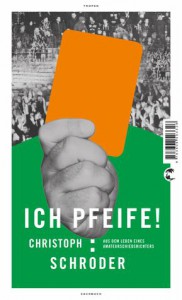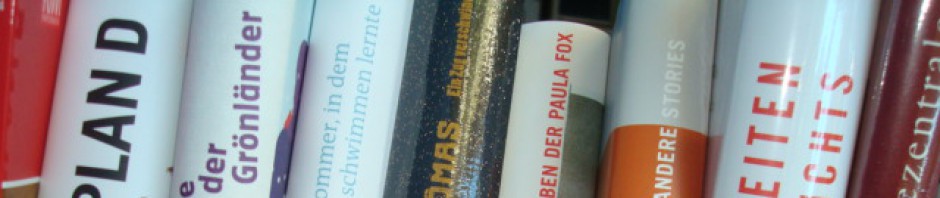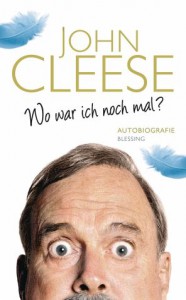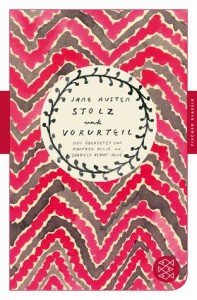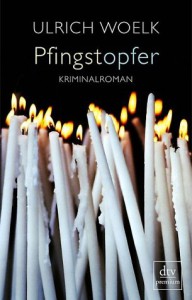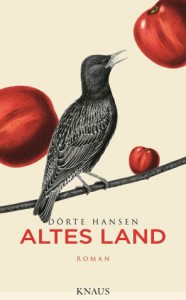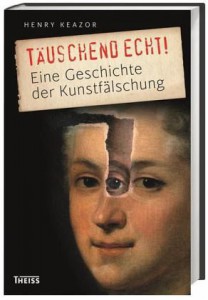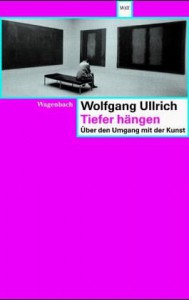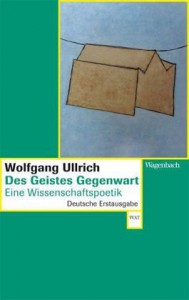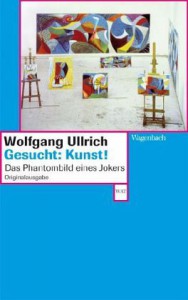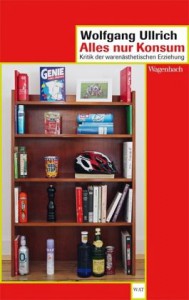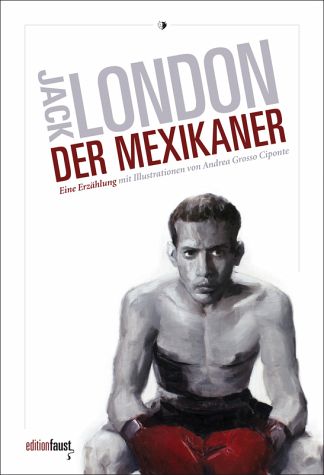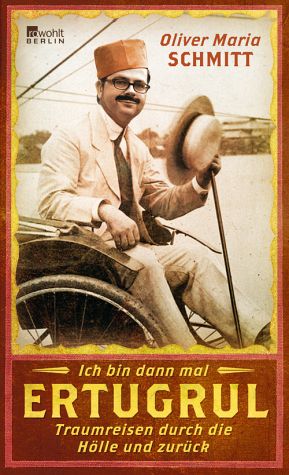“Studien am Duschgel”
Wolfgang Ullrich war lange Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie in Karlsruhe und hat seine Professur jetzt zurückgegeben, um wieder als freier Autor zu arbeiten. Er ist einer der hellsten und originellsten Köpfe, die sich gegenwärtig hierzulande der Kunsttheorie widmen. In mehreren Studien ging Ullrich der Frage nach, welchen Folgen diese schier grenzenlose Aufwertung und Befreiung der Kunst für die Kunst selbst hat. Tiefer hängen ist der Titel eines seiner Bücher und zugleich wohl als Ratschlag zu verstehen angesichts der Glorifizierungsbereitschaft, die den Kunstbetrieb inzwischen prägt. An der so oft wie inständig beschworenen Macht der Kunst zweifelt er: „Im Drogeriemarkt lässt sich mehr über unsere Gesellschaft lernen als im Museum für zeitgenössische Kunst“. Ich habe ihn in Leipzig zu einem Gespräch getroffen. Es wurde am 16. Mai 2015 im Nachrichtenmagazin Focus in gekürzter Form gedruckt. Hier ist es in voller Länge und Schönheit zu besichtigen.
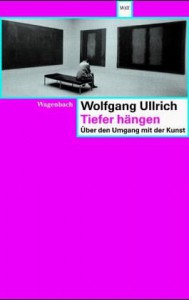
Wolfgang Ullrich: "Tiefer hängen. Über den Umgang mit der Kunst". Wagenbach Verlag, 11,90 Euro
Uwe Wittstock: Der Kunst wird viel zugetraut. Angeblich läutert sie die Menschen durch ästhetische Erziehung oder ist eine fundamentale Gegenwelt zur schnöden Realität oder liefert radikal neue, revolutionäre Ideen oder trägt zur quasireligiösen Sinnstiftung bei. Ist das nicht ein bisschen viel? Kann sie solche Erwartungen erfüllen?
Wolfgang Ullrich: Ja, das ist offensichtlich zu viel. Manchmal kommt es mir vor, als stellten Kunsttheoretiker solche pauschalen Behauptungen auf, um die Bedeutung ihres eigenen Metiers möglichst gewichtig erscheinen zu lassen. Zunächst muss man aber unterscheiden, welche Kunstgattung welche Wirkungen erreichen kann. Jeder hat sicher schon einmal erlebt, wie sehr ihn Musik ergriffen hat. Darin kann man eine – vielleicht vorübergehende – Läuterung der Zuhörer sehen. Ähnliches kann mit Film, Oper, Theater gelingen. Doch wäre es Unsinn, eine vergleichbare Wirkung von einer Ausstellung, einer Skulptur oder der Architektur zu erwarten. Literatur dagegen eignet sich, neue Ideen oder Lebenshaltungen durchzuspielen. Weil einzelne Künste manches ganz gut können, entsteht der Eindruck, „die“ Kunst könnte nahezu alles. Aber das ist eine klare Überforderung.
Wittstock: Woher kommen diese übergroßen Erwartungen?
Wolfgang Ullrich: Noch vor 250 Jahren war die Kunst fast ausschließlich eine Sache der Adligen. Sie vergaben Aufträge an die Künstler, unterhielten Orchester oder besaßen Kunstsammlungen. Der Adel schmückte sich mit der Kunst, auch um seinen Herrschaftsanspruch zu unterstreichen. Die Bürger versuchten sich dagegen zu behaupten, indem sie betonten, für sie sei Kunst weniger Besitz und Schmuck als vielmehr ein enormes inneres Erlebnis. Und um dieses innere Erleben der Kunst noch weiter aufzuwerten, wurde es in der Kunsttheorie gern als lebens- oder weltverändernde Kraft beschrieben. Das wurde dann zum Maßstab für den Umgang mit der Kunst: Wer erlebt am meisten? Wer kann ihr am meisten Sinn abgewinnen. Wer entdeckt in ihr die revolutionärsten Ideen?
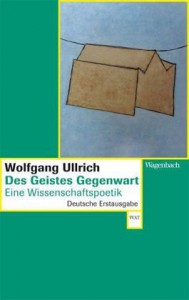
Wolfgang Ullrich: "Des Geistes Gegenwart. Eine Wissenschaftspoetik". Wagenbach Verlag, 11,90 Euro
Wittstock: Für die Adligen war der Künstler ein Handwerker und Entertainer. Für den Bürger ein Genie, das alle Regeln sprengte?
Wolfgang Ullrich: Ja, der Adel rechtfertigte seine Herrschaft durch Stammbäume, die über Jahrhunderte zurückreichten. Der Bürger hatte keinen Stammbaum, er war ein Individuum, und das wurde damals als Defizit empfunden. Deshalb nahm der Bürger sich den Künstler als Vorbild, der als Individuum große Werke schuf und sich dabei nur auf sich selbst berief. Der wurde zum Genie stilisiert, das ganz aus sich heraus, ohne Rückhalt, große Werke vollbrachte.
Wittstock: Hat die Kunst in unserer Gesellschaft heute an Bedeutung verloren?
Wolfgang Ullrich: Das hängt davon ab, was man unter Bedeutung versteht. Der Kunstmarkt hat in den letzten Jahren eine ungeheure Ausweitung und Aufwertung erlebt. Auch die Zahl der großen Ausstellungs-Events – wie der Documenta – ist gewachsen, ebenso die Zahl der Besucher. Andererseits richtet sich die Gesellschaft heute nicht mehr so stark nach dem Geschmack oder den Überzeugungen von Malerfürsten oder Dichterfürsten aus, wie das früher einmal der Fall war. Die Rolle als Orientierungsfiguren haben die Prominenten und die Stars übernommen – unter denen manchmal auch Künstler zu finden sind.
Wittstock: Auch die öffentliche Hand gibt nach wie vor eine Menge Geld für die Kunst aus: Museen werden gebaut, Theater finanziert, Kunsthochschulen unterhalten. Das zeigt, wie tief die Überzeugung sitzt, Kunst sei für die Gesellschaft insgesamt sehr wichtig.
Wolfgang Ullrich: Ja, ohne die Vorstellung von einer lebensverändernden und sinnstiftenden Kraft der Kunst lässt sich das alles nicht erklären. Auch die zahllosen Aktionen der Kulturvermittlung zielen letztlich darauf, möglichst viele Menschen mit der Kunst in Berührung zu bringen, damit die Kunst auch an ihnen ihre segensreiche Wirkung entfalten kann. Da haben sich Kunstreligion und Sozialdemokratie miteinander verbündet.
Wittstock: Sie schreiben, Theorien im allgemeinen, aber damit natürlich auch Theorien über Kunst könnten niemals wahr sein. Es sind immer nur Interpretationen, die uns einleuchten oder nicht, und die schnell durch andere Interpretationen ausgetauscht werden können. Warum können wir uns dann die Mühe der Interpretationen nicht sparen?
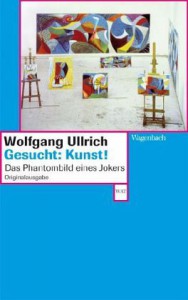
Wolfgang Ullrich: "Gesucht: Kunst!. Das Phantombild eines Jokers". Wagenbach Verlag, 14,90 Euro
Wolfgang Ullrich: Weil unsere Welt sehr arm wäre ohne unsere Interpretationen. Wir brauchen ja Orientierung, die stellt sich nicht von alleine her. Diese Orientierung liefern uns die Interpretationen oder Theorien, denen wir folgen können. Wir können nicht leben ohne Interpretation, nicht ohne für uns eine sinnvolle Ordnung ins Leben zu bringen. Das ist wichtig und eine ernste Sache. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es keinen allgemeingültigen Sinn gibt. Jeder von uns legt sich seinen zurecht, aber er kann dafür nicht mehr Wahrheit beanspruchen als andere für ihren.
Wittstock: Nach verbreiteten Vorstellungen der Moderne hat Kunst autonom, also unabhängig zu sein und nur ihren eigenen Gesetzen zu folgen. Ist eine solche totale Unabhängigkeit überhaupt möglich?
Wolfgang Ullrich: Streng genommen nicht. Es gibt nichts, das voraussetzungslos wäre. Also kann es auch kein Kunstwerk geben, das frei von Voraussetzungen und damit Abhängigkeiten wäre. Aber die Idee von der Autonomie der Kunst ist dennoch wichtig: Damit gewinnt die Kunst einen Raum der Immunität, in dem sie weitgehend frei ist. Im Museum oder auf der Theaterbühne bedeuten die Dinge etwas anderes, als wenn sie im Alltag stattfinden. Künstler können in diesem autonomen Freiraum Sachen ausprobieren, die unnütz, schockierend, verspielt oder auch skandalös sind, ohne dass sie gleich mit den Maßstäben des alltäglichen Lebens gemessen werden. Die Kunst ist das Als-ob. Auf der Bühne darf man so tun, als ob man jemanden ermordet, ohne in Verdacht zu geraten, kriminell zu sein. Jonathan Meese darf in Rahmen einer Performance den Hitlergruß machen.
Wittstock: Halten sich die Künstler denn an diesen Freiraum? Einer der wichtigsten Surrealisten, André Breton, schrieb einmal, der einfachste surrealistische Akt sei es, mit Revolvern aus dem Haus zu treten und blind in die Menschenmenge zu feuern.
Wolfgang Ullrich: Ja, manche Avantgardisten betrachteten sich als autonome Künstler, wollten aber die Trennlinie zwischen Kunst und Leben beseitigen. Die Gesellschaft sollte sich ihren Vorstellungen unterwerfen. Damit bekam die Avantgarde brutale und diktatorische Züge. Piet Mondrian zum Beispiel reduzierte in seinen Bildern alles auf rechte Winkel und die Grundfarben – und forderte, alle Menschen müssten nach diesen Formprinzipien leben, nur so könne eine gute Welt entstehen. In solchen Fällen wird Kunst gefährlich. Dann muss man die Künstler daran erinnern, dass sich ihre Freiheit auf den Kunstraum beschränkt.
Wittstock: Kunstwissenschaftler sind, schreiben Sie, hauptsächlich damit beschäftigt, Kunstwerke als besonders bedeutend und bewundernswert hinzustellen. Sie steigern also den Wert auf dem Kunstmarkt. Das kritische Urteil ist unter Wissenschaftlern fast ausgestorben. Muss ich den Wissenschaftlern also konsequent misstrauen, da sie mit ihrer Arbeit ohnehin nur die Kunstpreise hochtreiben?
Wolfgang Ullrich: Das ist eine seltsame Selbstbeschränkung viele Kunstwissenschaftler. Vielleicht entsteht sie auch durch Gewohnheit oder Gedankenlosigkeit: Kunstwerke werden von ihnen nahezu unterschiedslos gefeiert. Dabei sind sie fast die Einzigen im Kunstbetrieb, die auch die Freiheit haben, differenziert zu werten und Schwaches schwach zu nennen. Museumsdirektoren müssen die Bedeutung ihrer Sammlung herausstreichen, das ist ihre Aufgabe. Autoren von Auktionskatalogen sind dazu gezwungen, die angebotene Kunst zu loben und für bedeutsam zu erklären. Der staatlich bestallte und bezahlte Kunsthistoriker jedoch ist frei im Urteil – und mich wundert, weshalb diese Freiheit so selten genutzt wird.
Wittstock: Nicht nur die Kunst bereichert das Leben mit ästhetischen Erfahrungen. Viele Konsumgüter leisten das auch. Ich denke an Steve Jobs, der mit nahezu religiöser Inbrunst die Schönheit von iPhone, iPad, iPod feierte. Kann ich als ästhetisch interessierter Zeitgenosse also auch auf Kunst verzichten und mich stattdessen an der Ästhetik hübscher Alltagsgeräte erfreuen?
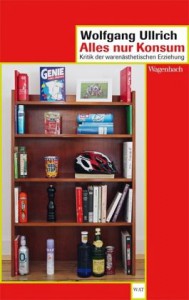
Wolfgang Ullrich: "Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung". Wagenbach Verlag, 12,90 Euro
Wolfgang Ullrich: Wer sich heute mit Ästhetik beschäftigt, um seine Gegenwart besser zu verstehen, sollte tatsächlich lieber in einen Baumarkt oder einen Supermarkt gehen als ins Museum. Was dort an ästhetisch gestalteten Produkten präsentiert wird, sagt sehr viel mehr über unsere Gesellschaft, unsere Werte, unser Denken, als es die Kunst tut. Gerade wenn Kunst autonom sein will, ist sie kein guter Seismograph für das, was die Gesellschaft an- und umtreibt. Sie folgt einer eigenen Logik, wogegen die Produkte, die uns in Supermärkten angeboten werden, durch aufwendige Marktforschung auf die Bedürfnisse der Gegenwart zugeschnitten sind. Da fließt in codierter Form enorm viel ein von den Wünschen und Werten einer Zeit – und lässt sich von den Produkten wieder ablesen. Bei der genauen Betrachtung eines Regals mit Duschgels im Drogeriemarkt zum Beispiel lässt sich mehr über unsere Gesellschaft lernen als durch ausführliche Studien im Museum für zeitgenössische Kunst. Es gibt Duschgels für jedes Milieu: für Aussteiger, für Liebhaber des Landlebens, für konkurrenzorientierte Leistungsträger, für verantwortungsbewusste Naturschützer usw.
Wittstock: Ist der ästhetische Genuss an einem Konsumgut nicht letztlich doch profaner als der an einem Kunstwerk? Ein Beispiel: Ich kann mich an der Schönheit des Kölner Doms erfreuen, ohne dass der Dom mir gehört. Aber seltsamerweise freuen sich die meisten Leute erst dann am iPhone, wenn sie eines besitzen.
Wolfgang Ullrich: Es gehörte zu den Grundüberzeugungen der Moderne, dass ein Kunsterlebnis nur dann wirklich rein und stark ist, wenn es nicht getrübt wird durch das Bedürfnis, das entsprechende Werk zu besitzen. Es ging, wie Kant es nannte, um das „interesselose Wohlgefallen“ an der Kunst. Das ist aus der Sicht des besitzlosen Bildungsbürgertums gedacht und einmal mehr gegen den Adel gerichtet gewesen. Dagegen steht die Erfahrung, dass viele sich einem Kunstwerk erst dann intensiv verbunden fühlen, wenn sie es besitzen, es nutzen und frei mit ihm umgehen können. Eigentlich liegt doch auf der Hand, dass mein ästhetische Genuss größer oder zumindest ein anderer ist, wenn ich das, was ich schön finde, auch besitzen und so in meinem Alltag erleben kann.