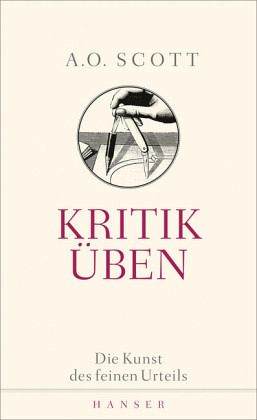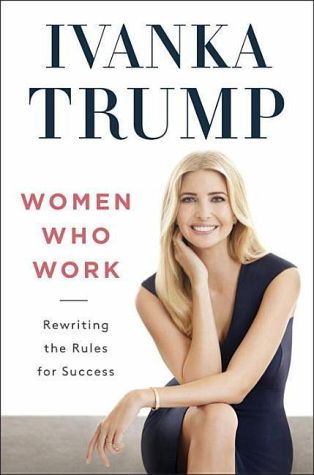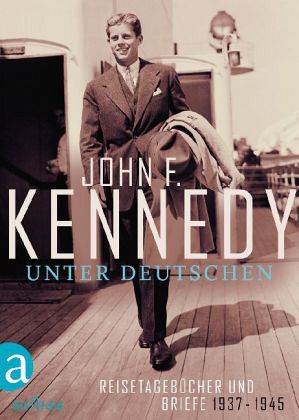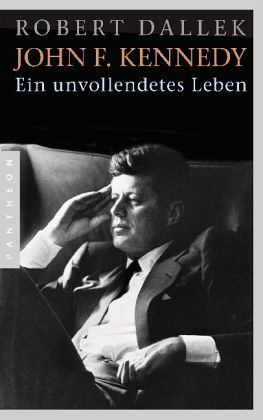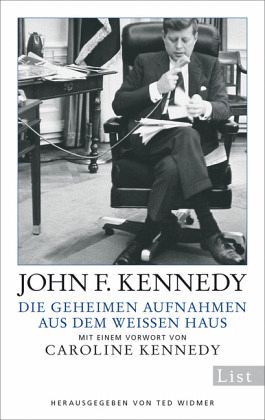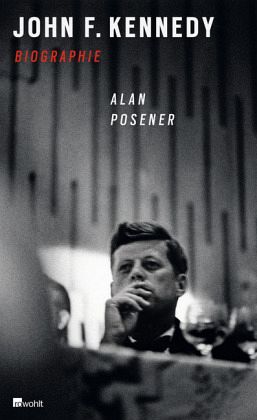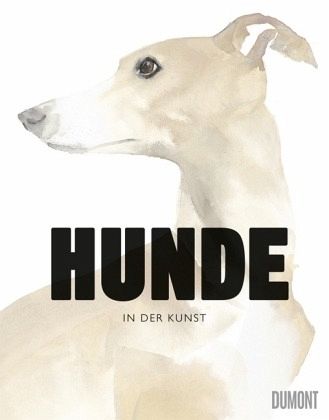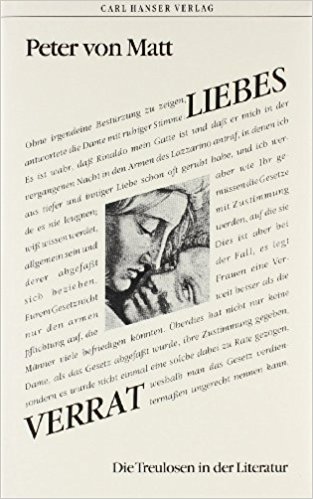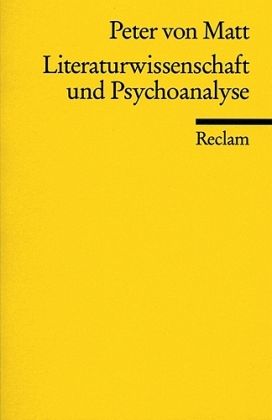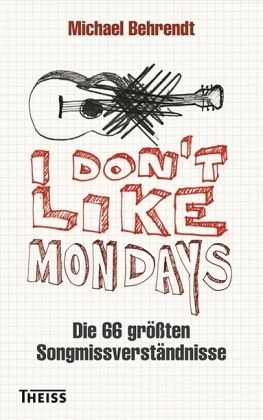Was wollen uns die Küsse sagen?
Eine Eloge auf Peter von Matt zum 80. Geburtstag
oder: Gibt es noch Nachtisch?
Ich lernte Peter von Matt vor über dreißig Jahren auf einer germanistischen Tagung in Bochum kennen. Damals war ich verblüffenderweise jünger als heute und wohl auch selbstgewisser. Ich arbeitete bei einer Zeitung, fühlte mich als Literaturkritiker, und meine Skepsis gegenüber der Literaturwissenschaft erreichte ihren Höhepunkt. Als Entschuldigung darf ich vielleicht anführen, dass ich zu jener Zeit an meiner Dissertation schrieb und deshalb gezwungen war, eine Überdosis germanistischer Spezialstudien zu meinem kleinen Forschungsgebiet zu mir nehmen. Für mich hatte sich der Eindruck verfestigt, nirgendwo auf der Welt werde uneleganter, kleinkarierter, kunstverständnisloser formuliert und argumentiert als ausgerechnet in der Germanistik. Und diese Tagung würde meine Überzeugungen vollauf bestätigen, so viel war sicher.

Peter von Matt: "Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur". Hanser Verlag. 22 Euro
Doch dann hielt Peter von Matt den Eröffnungsvortrag, es ging um „Spiele des Lachens“ in der Literatur, und ich war von meiner Skepsis kuriert. Er formulierte elegant, mit weitem intellektuellen Zuschnitt und einem beneidenswerten Fingerspitzengefühl für die Antriebskräfte der Schriftsteller. Er sprach über „Spiele des Lachens“ und brachte sein Publikum dabei zumindest zum Lächeln, und was er sagte, schärfte nicht nur den Blick auf die Literatur, sondern auch aufs Leben.
Peter von Matt erzählte, ja wirklich: er erzählte unter anderem von Caroline Schlegels Reaktion auf ein zu ihrer Zeit frisch erschienenes, heute längst zum Monument erstarrtes Stück deutscher Lyrik, und von dem schönen Satz, den sie an einen ihrer Briefpartner schrieb: „Über ein Gedicht von Schiller, das Lied von der Glocke, sind wir gestern Mittag fast von den Stühlen gefallen vor Lachen.“ Und tatsächlich war, wie Peter von Matt leichthändig zeigte, die aus formal perfekten, idealistischen, todernsten Versen erbaute Welt der Schiller-Glocke schreiend komisch, sobald man sie mit den Augen eines Menschen anschaute, der an der keineswegs so perfekten und idealen Einrichtung der realen Welt litt wie Caroline Schlegel. Peter von Matt sprach, wenn ich mich heute, dreißig Jahre danach noch richtig entsinne, von dem „verharmlosenden Ernst“, zu der die Literaturwissenschaft bei der Betrachtung von Literatur neige und von der radikalen Sprengkraft der Komik, die mit literaturwissenschaftlichen Begriffen so schwer zu fassen ist.
Durch allerlei dreiste Manöver gelang es mir, bei dem Mittagessen, das auf seinen Vortrag folgte, einen Platz neben Peter von Matt zu ergattern. Ich weiß nicht, wie sehr ich ihm mit meinem Versuch, von meiner Bewunderung für seine Arbeit zu reden, beim Essen auf die Nerven gegangen bin. Scham überkommt mich, wenn ich daran denke. Aber eines weiß ich noch genau: Irgendwann ließ Peter von Matt seinen Blick über den Mittagstisch wandern, jenen Blick, mit dem er immer wieder entscheidende, zuvor übersehene Details in den Werken der Schriftsteller entdeckte, um sie seinem staunenden Publikum vorzulegen, Peter von Matt also ließ seinen Blick über unseren Tisch wandern, ergriff einen der kleinen Löffel, die bei den Tellern der Mittagsgäste lagen, hielt ihn hoch und fragte mich: „Was bedeutet das?“ Ich hatte keinen blassen Schimmer. Woraufhin Peter von Matt vorfreudig lächelte und sagte: „Das bedeutet: Wir kriegen noch Nachtisch.“
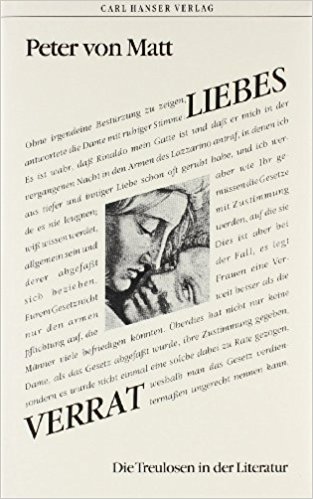
Peter von Matt: "Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur". Hanser Verlag. 20,99 Euro
Seither zählt Peter von Matt zu meinen Stars der Germanistik. Seine Bücher sind eine Leselust, er ist ein Stilist von Gnaden, ein weiser Mann der Literatur, der sein enormes Wissen mit Charme und Witz, mit intellektueller Präzision und tänzerischer Leichtigkeit austeilt. Sein jüngstes Buch „Sieben Küsse“ ist ein prachtvolles Beispiel für diese seine Kunst, der Sprache der Schriftsteller nachzulauschen und das, was sie sagen, deutlicher ins Bewusstsein zu heben.
Denn die Literatur hat, schreibt er, ihren eigenen Blick auf die Welt. Sie ist ein uraltes System der Welterklärung ebenso wie Wissenschaft, Philosophie oder Religion. Die Schriftsteller denken in Szenen, so wie die Philosophen in Begriffen und Theorien denken. Für die Literatur zählt immer nur der lebendige Einzelfall, das konkrete Detail – aber sie vermag den Einzelfall, das Detail symbolisch aufzuladen und ihnen so zu überlebensgroßer Bedeutung zu verhelfen. Denn die Literatur, sagt von Matt, „hat sich, im Unterschied zu den andern Systemen, nie ganz abgelöst vom Blick des Kindes. Für das Kind gibt es noch keine Ordnung der Dinge. Alles kann riesig sein oder wie nicht vorhanden. Ein Stein auf dem Weg ist kostbar wie der Rubin in der Königskrone. Er ist sogar lebendig wie ein Tier.“
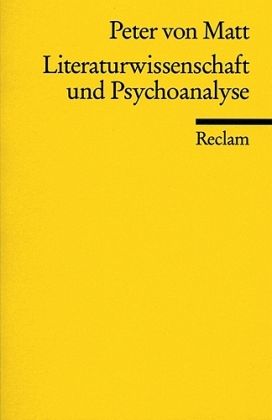
Peter von Matt: "Literaturwissenschaft und Psychoanalyse". Reclam Verlag. 6 Euro
Und weil, so von Matt, Literatur Wege zeigt, die aus den üblichen Hierarchien und Ordnungsmuster hinausführen, kann sie verschollene, ins unbewusste abgesunkene Erfahrungen wachrufen, „Erfahrungen aus den Urzeiten des eigenen Lebens oder Erfahrungen aus den Urzeiten der Menschheit“. Natürlich wird auch in der Literatur über solche Erfahrungen nachgedacht, aber da diese Erfahrungen in Szenen vergegenwärtigt werden, nicht in Begriffen oder Theorien, bleibt in ihnen immer ein unausdeutbarer Rest, etwas, das man erahnen, aber nicht ganz und gar erklären kann. Wie immer man sich über dieses Denken in Szenen „innerhalb oder außerhalb des Textes den Kopf zerbricht, zu einem vollständig in Sprache übersetzten Verständnis gelangt man nie.“
Wie aber, fragt von Matt, geht das Welterklärungssystem Literatur mit der Sehnsucht nach dem Glück um? Das ist das Forschungsprojekt seines neuen Buches „Sieben Küsse“ (Hanser, 22 Euro). Da die Literatur in Szenen denkt, spricht sie auch von dieser Sehnsucht in Szenen und eine der Urszenen des Glückes ist der Kuss. Also spürt von Matt sieben großen Kussszenen der Weltliteratur nach, Küssen, mit denen das Leben ein anderes wird für die küssenden Geschöpfe der Literatur, Küsse, in denen sich das verdichtet, was die Schriftsteller zur Sehnsucht nach dem Glück zu sagen haben.
Er findet diese Szenen im „Großen Gatsby“ des Amerikaners F.Scott Fitzgerald, im Roman „Mrs Dalloway“ der Engländerin Virginia Woolf, in Erzählungen des Schweizers Gottfried Keller und des Österreichers Franz Grillparzer, in der „Marquise von O.“ des unpreußischen Preußen Heinrich von Kleist, in einem Kurzroman der Französin Marguerite Duras und einer Shortstory des Russen Anton Tschechow. Wie gesagt, Peter von Matts Horizont ist niemals eng, er klammert sich weder an Epochen- noch an Sprachgrenzen. Und ihm gelingt immer wieder, was in der Literaturwissenschaft häufig genug nicht einmal versucht wird: Er macht neugierig, ja regelrecht gierig auf die Bücher, über die er schreibt. Das liegt zum einen daran, dass er, der über die Kunst des Erzählens schreibt, zugleich eine Kunst des Nacherzählens beherrscht, und keine Mühe scheut, seinen Lesern die Geschichten, von denen er spricht, auch vor Augen zu rücken. Zum andern liegt es an seiner Fähigkeit, diese Geschichten eben nicht als bloße Objekte der Analysen zu behandeln, sondern als kunstvolle Versuche der Schriftsteller, Erfahrungen zur Sprache zu bringen, die auf anderem Weg schwer oder gar nicht zu formulieren sind.

Peter von Matt: "Das Wilde und die Ordnung. Zur deutschen Literatur". Hanser Verlag. 24,90 Euro
Literatur ist nämlich für Peter von Matt kein Spaß – auch wenn es ein großes Vergnügen ist, seinen Argumentationen zu folgen. Wenn er schreibt, dass Literatur ein Versuch der Welterklärung ist, dann ist das auch so zu verstehen, dass die Welt der Erklärung bedarf, dass wir oft vor Rätseln stehen, die uns nicht selten quälen, und wir froh sein dürfen, diesen Rätseln mit der Macht der Literatur zu Leibe rücken zu können. Literatur hat nicht immer Recht, warnt von Matt ausdrücklich. Aber unausgesprochen liegt in dieser Warnung das Versprechen, manchmal habe sie eben doch Recht und könne dabei helfen, das rätselvolle Leben etwas weniger rätselhaft machen und uns in ihm ein bisschen heimischer.
Dazu muss man Literatur allerdings genau lesen und zu verstehen versuchen, was in dem Text steht, und nicht die Theorien in ihn hineinlesen, die man ohnehin schon im Kopf hat. In Kleists „Marquise von O.“ zum Beispiel gibt ein Vater seiner verloren geglaubten, aber für ihn dann doch geretteten Tochter einen Kuss, der kein einfacher Kuss mehr ist, sondern eine wahre Kussorgie. Die feministische Literaturtheorie interpretiert diese skandalöse Szene gern als patriarchalischen Gewaltakt, als inzestuöse Beinahe-Vergewaltigung der zu Anfang der Novelle bereits vergewaltigten Marquise. Doch von Matt zeigt, dass diese Interpretation nicht aufgehen kann, wenn man liest, was Kleist tatsächlich geschrieben hat, und diese Szene ein Skandal extremer Gefühle bleibt, die sich üblichen Deutungsmustern nicht fügt.
Peter von Matts Grundüberlegung in diesem Buch, die Literatur denke in Szenen, ist selbstverständlich nicht als absolute Maxime gedacht. Niemand muss von Matt erklären, dass es unszenische Formen von Literatur gibt, denen man Gedankenarmut gleichwohl nicht nachsagen kann. Dennoch verstehe ich von Matts Lehrsatz auch als einen klugen Hinweis auf die besonderen Qualitäten des Erzählens, von dem manche Parteigänger der literarischen Moderne so gern behaupten, es sei längst überlebt und im Rahmen eines ernsthaften ästhetischen Nachdenkens nicht mehr satisfaktionsfähig. Wer heute an die erzählerischen Traditionen des Denkens in Szenen anknüpft, fesselt sich deshalb noch lange nicht an billige literarische Konventionen – auch das ist in von Matts fabelhaftem Buch über „Sieben Küsse“ zu lernen.
Für mich persönlich hat Peter von Matt nur einen Nachteil. Er lebt in Zürich. Und Zürich liegt, aus welchen Zufällen auch immer, unglücklicherweise weitab von meinen Reisepflichten. Wäre das anders, hätte ich längst wieder einmal allerlei dreiste Manöver unternommen, um ihn zu einem Essen und einem Gespräch über Literatur zu gewinnen. Zu einem Essen samt kleinem Löffel, der ihm von Anfang an verspricht: „Wir kriegen noch Nachtisch.“