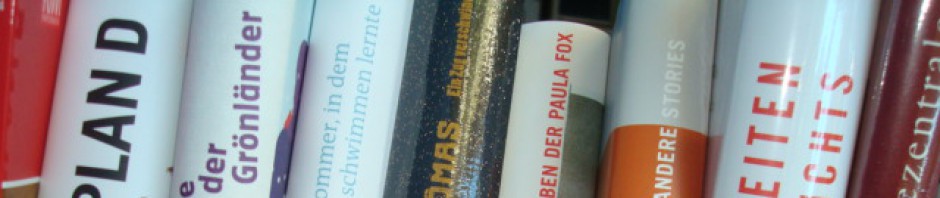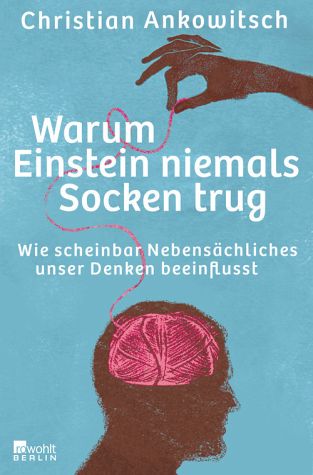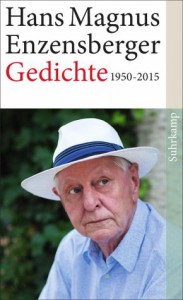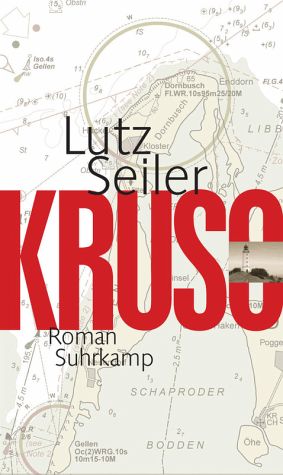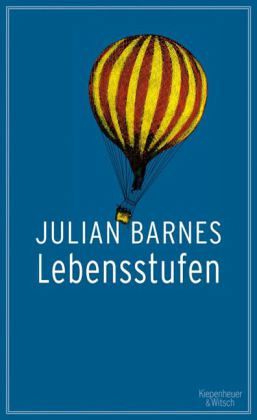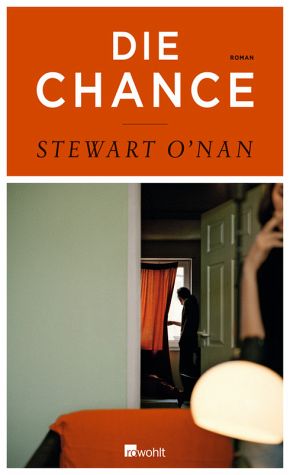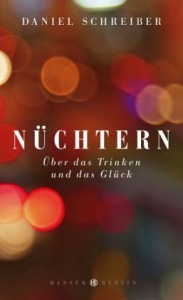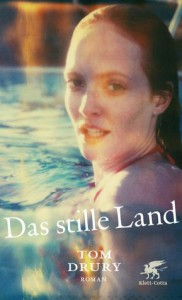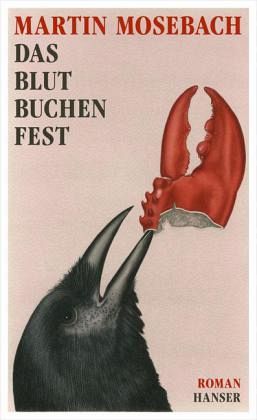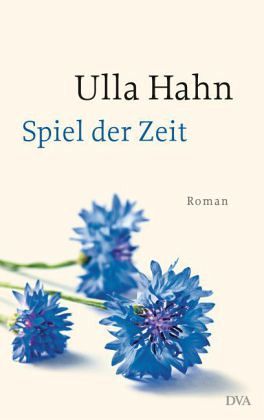Liebe in den Zeiten der Rebellion
Ulla Hahn gehört zu den bekanntesten Lyrikerinnen Deutschlands. Doch auch ihre Romane haben eine riesige Leserschaft gefunden. In Spiel der Zeit erzählt sie von der Studentenbewegung rund ums Jahr 1968. Es geht um die angeblich so große Rebellion, aber auch um die Tochter einer Arbeiterfamilie, die Kölsch spricht, Hochdeutsch lernt, Studentin wird und sich verliebt in einen Mann, der sie in eine großbürgerliche Welt versetzt. Es geht um das Trauma einer Vergewaltigung und um die glücklich wiedereroberte sinnliche Freude am Leben.
Ich treffe Ulla Hahn in Hamburg an einem der nördlichen Zipfel der Außenalster. Sie spricht, wie fast immer, klar, offen, entschlossen und zugleich in einem leise belustigten, ironischen Tonfall.
Uwe Wittstock: Mit Verliebten ist keine Revolution zu machen, schreiben Sie in Ihrem neuen Buch. Warum nicht?
Ulla Hahn: Weil Verliebte alles haben, was sie brauchen. Sie vermissen nichts. Man rebelliert, wenn man unzufrieden ist mit dem gegebenen Zustand. Doch dieser Stachel fehlt den Verliebten. Sie sind zu glücklich, um sich aufzulehnen.
Wittstock: Sie waren 1968 Studentin, sehr verliebt und sehr glücklich, das merkt man Ihrem autobiografischen Roman an. Aber zugleich hatten Sie einen Blick für soziale Missstände. Wollten Sie trotzdem nicht mitrebellieren?
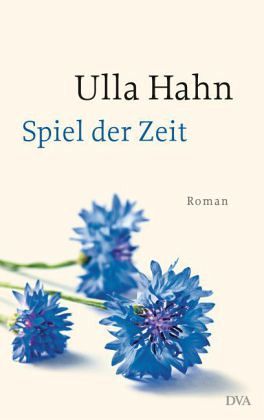
Ulla Hahn: "Spiel der Zeit". Roman. DVA, München 2014. 24,99 Euro
Ulla Hahn: Die meisten 68er, die damals auf die Straße gingen, litten kaum unter sozialen Missständen. Im Gegenteil, es waren häufig Kinder aus Familien, die alles hatten. Sie waren materiell abgesichert, hatten beste Berufsaussichten und feierten eine Art politischen Karneval, bei dem sie nicht mit Bonbons, sondern mit halb verstandenen, angeblich revolutionären Begriffen um sich warfen. Mir als Kind aus einer Arbeiterfamilie konnte man damit nicht kommen. Mein Irrweg war später ein anderer. Warten Sie auf mein nächstes Buch!
Wittstock: Haben die 68er gesiegt? Sind sie gescheitert? Oder beides?
Ulla Hahn: Die im engeren Sinne politischen Ideen, die kommunistischen oder maoistischen Spinnereien, sind ausnahmslos gescheitert, Gott sei Dank. Vom antiautoritären Impuls jener Zeit hat sich manches durchgesetzt. Ob man das heute immer noch in jeder Hinsicht begrüßt, ist eine andere Frage. Die
68er haben mitgeholfen, das Land freier und lockerer zu
machen. Auf dieses liberale Klima würde heute, glaube ich, keiner verzichten wollen.
Wittstock: Trafen die Studenten bei diesen Lockerungsübungen auf Widerstand bei den sogenannten guten Bürgern?
Ulla Hahn: Kaum. Die meisten „guten Bürger“ waren mit Begeisterung dabei, wenn es um neue Mode, neue Musik und freie Liebe ging. Keiner wollte als Spießer gelten, jeder wollte dabei sein, wollte in sein und seinen Spaß haben. Auch die tonangebenden Schriftsteller dieser Zeit, die meist 20 Jahre älter als die Studenten waren, sprangen auf den Zug auf und setzten ihren Lesern plötzlich lauter politisierte Geschichten oder Statements vor. Sie lieferten eine Literatur, die jedem, der sich für einen Revolutionär hielt, jederzeit ein gutes Gewissen verschaffte.
Wittstock: War 1968 eine Rebellion ohne Gegner?
Ulla Hahn: Ich habe versucht, die Stimmung jener Zeit in meinem Roman einzufangen. Es gab nur wenige, die sich ihr entziehen konnten. Diese Stimmung des Aufbruchs in eine wunderbare utopische Zukunft hatte kaum etwas mit der Realität zu tun. Sie schwebte wie ein Traum, wie ein romantischer Traum über allem. Wenn man heute Reden von Rudi Dutschke hört, merkt man, dass es dabei kaum auf seine oft wirren politischen Thesen ankam. Die verstand ohnehin keiner. Es war sein Tonfall, der die Zuhörer mitriss. Er war ein Poet, er hätte ebensogut Gedichte vortragen können, große Oden.
Wittstock: Der Roman erzählt auch die Geschichte eines sozialen Aufstiegs vom Arbeiterkind zur Studentin mit großbürgerlichem Geliebten. Gab es für Sie Hilfe auf diesem Weg?
Ulla Hahn: Ohne Hilfe, nein besser: ohne Helfer geht das nicht. Es braucht Menschen, die einem die Hand hinstrecken und einen ein Stück weiterführen. Ich hatte ungeheures Glück, immer wieder solche Menschen zu treffen. Mir ging es auch darum, in meinem Buch diesen Menschen, vor allem Lehrern, ein literarisches Denkmal zu setzen. Lehrer werden gern kritisiert. Ich habe Grund, den meinen zu danken.
Wittstock: Sobald die Studentin im Roman ihre Familie besucht, spricht sie Kölsch. Wann haben Sie Hochdeutsch gelernt?
Ulla Hahn: Kölsch ist meine Muttersprache. Bis ich sechs Jahre alt war, wusste ich nicht, dass es so etwas gibt wie Hochdeutsch. Ich habe es mir dann auf der Realschule beigequält. Weil ich endlich so sprechen wollte wie die anderen. Ich wollte die schöne Sprache sprechen. Die Sprache, die ich heute schreibe, ist eigentlich gar nicht meine Muttersprache.
Wittstock: Nach Ihrem Weg vom Arbeiterkind zur Schriftstellerin: In welchem Milieu fühlen Sie sich heute zu Hause?
Ulla Hahn: Das ist nicht einfach. Wer sich verändert, lässt immer auch etwas zurück. Das ist mir beim Schreiben sehr klar geworden. Die Welt, in der meine Verwandten
leben, habe ich verloren. Und bin ich zu Hause in der Welt, in der ich jetzt lebe? Es bleibt da immer ein haarfeiner Riss. Was für die anderen selbstverständlich ist, lässt mich den Bruchteil einer Sekunde zögern. Dann spüre ich, wie schwer es für mich ist, ganz und gar
dazuzugehören. Ich kann damit umgehen, aber Aufstieg bedeutet immer auch Verlust. Und wie schwer, denke ich manchmal, muss ein ähnlicher Weg für Kinder mit Migrationshintergrund sein.
Wittstock: Ihr Roman spielt in der 68er-Zeit, ist aber auch ein Hohelied der Liebe. Und das, obwohl Ihre Heldin eine der schlimmsten Erfahrungen gemacht hat, die einer Frau
widerfahren können: eine Vergewaltigung.
Ulla Hahn: Über so etwas wie Vergewaltigung konnte man Anfang der 60er-Jahre nicht sprechen. Mit niemandem. Und weil man darüber nicht sprechen konnte, gab es auch keine Hilfe. Damit war man allein. Mit ihrem geliebten Freund kann sich meine Heldin endlich alles von der Seele reden, wie es so schön heißt, und dadurch wieder zu einer Einheit von Leib und Seele finden, also auch wieder sinnliche Freude am Leben haben. Und die genießt sie in vollen Zügen.
Wittstock: Ihr Buch ist eine Seltenheit. Es gibt nur sehr wenige Romane über die 68er-Zeit. Warum?
Ulla Hahn: Es ist nicht einfach, die einzigartige, seltsame und bedenkenlose Stimmung jener Jahre zu erfassen. Dieser maßlose Unsinn, den viele Leute damals nicht nur geredet, sondern auch geglaubt haben! Das ist womöglich eher peinlich, keiner möchte wahrhaben, was für himmelschreiend dumme Dinge er damals gesagt und gedacht hat.
Wittstock: Vielleicht ist es leichter, aus weiblicher Sicht über diese Zeit zu schreiben.
Ulla Hahn: Die Frauen sind die wahren Gewinner der 68er-Zeit. Vorher durften sie nicht einmal arbeiten, ohne ihren Mann um Erlaubnis zu fragen. Gewalt in der Ehe, um die Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, war in gewissen Grenzen erlaubt. Eine verheiratete Cousine von mir wurde, als sie viereinhalb Jahre
lang kein Kind bekommen hatte, vom Pfarrer streng befragt, ob sie etwa verhüte. All das gibt es heute nicht mehr, und dafür können wir auch den 68ern dankbar sein.