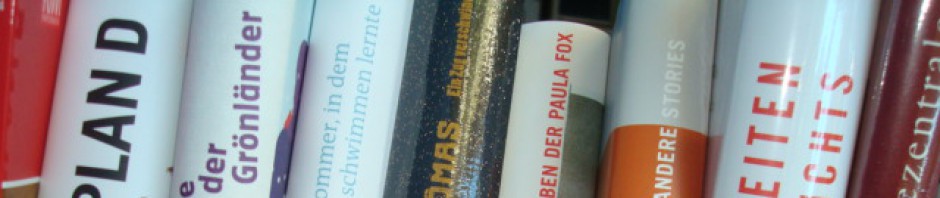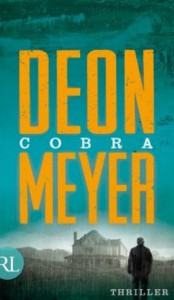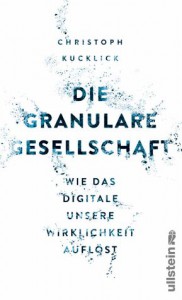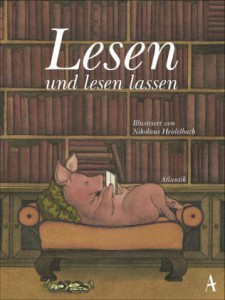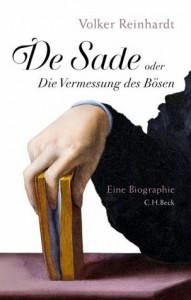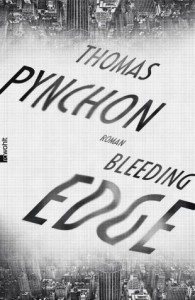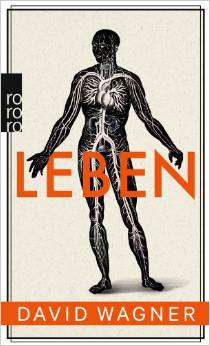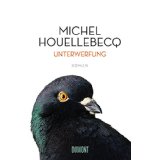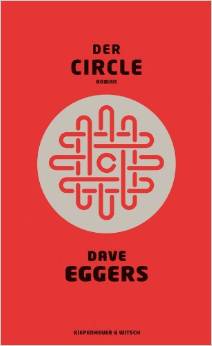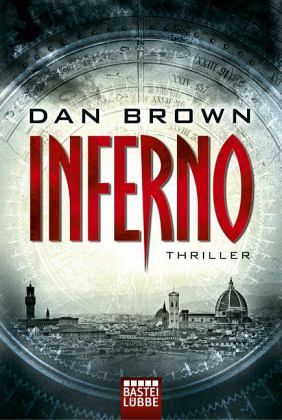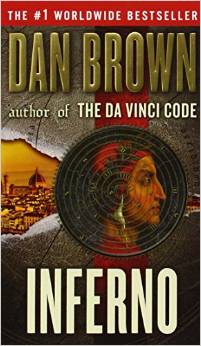Zur Kunst des Reisens gehört das Ankommen
Gleich sein Erstling war ein Triumph: Für den Familienroman In Zeiten des abnehmenden Lichts wurde Eugen Ruge 2011 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, der fast immer Bestsellerplätze garantiert. Auch sein zweiter Roman Cabo de Gata, der von einem Winter am spanischen „Kap der Katzen“ erzählt, hat ein großes Publikum erobert. Es geht um den Versuch, alle Brücken hinter sich abzubrechen, um das Problem über spirituelle Erfahrungen zu schreiben und den Versuch, ohne Botschaft zu erzählen
Uwe Wittstock: Herr Ruge, der Held Ihres Romans Cabo de Gata kündigt alles: Wohnung, Arbeit, Kranken- und Rentenversicherung. Den Rest seines Lebens packt er in einen Rucksack und zieht in Richtung Süden. Ist das ein Traum oder ein Albtraum?

Eugen Ruge: "Cabo de Gata". Rowohlt Taschenbuch Verlag, 10,99 Euro
Eugen Ruge: In diesem Fall ist es zuerst ein Traum und dann eine Ent-Täuschung. Seine Täuschung besteht darin zu glauben, sobald er in die Fremde geht, werde ihm etwas gelingen, was er zu Hause nicht zu Stande bringt. Er will einen Roman schreiben und Schriftsteller werden.
Wittstock: Jedes Jahr zieht es Millionen Deutsche in den Süden. Doch Ihr Held kommt nicht zur Urlaubszeit, sondern im Winter in Spanien an und friert wochenlang entsetzlich.
Eugen Ruge: Ja, das ist Teil seiner Enttäuschung. Die Vorstellung, die Dinge könnten anderswo automatisch besser werden als daheim – eine Vorstellung, die gar nicht so selten ist –, wird für ihn auf vielfältige Weise enttäuscht. Am Strand liegt Müll, die Bude, in der er wohnt, ist gar nicht romantisch, sondern scheußlich und kalt, und auch mit dem Bücherschreiben geht es nicht besser voran als zu Hause. Der entscheidende Schritt für ihn ist, daraufhin nicht schon wieder seinen Rucksack zu packen und weiterzuziehen. Sondern er bleibt, halb aus Geldnot vermutlich, aber auch, weil er sich entschließt, der Enttäuschung standzuhalten. Von diesem Moment an beginnt er sich tatsächlich zu verändern.
Wittstock: Braucht man also doch gelegentlich Tapetenwechsel, um sich verändern zu können?
Eugen Ruge: Da ich gerade aus China komme: Laotse sagt, wer das Tao hat, kann gehen, wohin er will. Anders gesagt, er kann auch zu Hause bleiben. Aber möglicherweise muss man auf Reisen gehen, um das zu erfahren. Nur reicht die Reise, der Tapetenwechsel, allein nicht aus. Ich kenne Leute, die reisen ständig überall auf der Welt herum und ändern sich gar nicht.

Reales Vorbild in Cabo de Gata für die fiktive Unterkunft des Schriftstellers aus Eugen Ruges gleichnamigem Roman
Wittstock: Führt die Reise Ihres Helden in ein Paradies?
Eugen Ruge: Tatsächlich verheißt ihm ein Schild am Straßenrand „Das letzte Paradies Europas“. Das unterstützt seine heimliche Hoffnung, endlich alle alten Probleme lösen oder loswerden zu können. Aber das Paradies entpuppt sich als Wüsten- oder Steppenlandschaft. Es ist keineswegs ein Idyll, sondern eher ein Ort großer Einsamkeit, genauer gesagt ein Ort, an dem er seine Einsamkeit noch stärker zu spüren bekommt.
Wittstock: Ein Paradies verspricht Erlösung. Findet Ihr Held in Cabo de Gata letztlich Erlösung?
Eugen Ruge: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, so viel darf man verraten: Letztlich erzählt der Roman die Geschichte eines Scheiterns, eines Misserfolgs. Aber trotz allem wird meine Figur dabei reicher. Wie das geschieht und wodurch, ist gar nicht so leicht zu sagen. Davon kann man schlecht sprechen, sondern allenfalls erzählen. Genau das versuche ich in diesem Roman. Es hat zu tun mit Langsamkeit, mit Verweilen, auch mit einer bestimmten Zurückgezogenheit – und all das steht im Gegensatz zu dem, was heute als wichtig empfunden wird: immer schnellere Kommunikation, permanenter Spaß, Abwechslung. Ich will daraus keine zivilisationskritische Ideologie ableiten, und Kommunikation und Abwechslung haben zweifellos etwas für sich. Ich will nur davon erzählen, welche Wirkung Langsamkeit und Einsamkeit haben können.
Wittstock: Die Romanfigur war Chemiker, bevor er Schriftsteller werden wollte. Sie waren einmal Mathematiker. Ist es ein großer Schritt vom naturwissenschaftlichen Denken zum literarischen?

Fischerboote im spanischen Cabo de Gata
Eugen Ruge: Ich musste lange gegen die Versuchung ankämpfen, in meinen Geschichten eine bestimmte Botschaft an den Leser bringen zu wollen. Es ist mir nicht leichtgefallen, einfach nur zu erzählen. Ob das nun mit meiner Vergangenheit als Mathematiker zusammenhängt oder mit der Tatsache, dass ich lange in der DDR lebte, weiß ich nicht. In der DDR hatten Literatur und Kunst ja unter anderem die Funktion übernommen, verschwiegene oder unterdrückte Meinungen erkennbar zu machen – und das war damals sicher wichtig und gut so. Übrigens nicht nur in der DDR, sondern auch in anderen Ländern und anderen Zeitaltern. Letztlich ist diese Funktion der Kunst nicht vollkommen fremd, Kunst kommt nämlich nicht von „Können“, sondern von „Künden“. Ein Schriftsteller, der heute in Algerien lebt, in China oder in Syrien, hat ganz andere Aufgaben als ein Autor in der Bundesrepublik Deutschland. Aber dieses Verkünden von Meinungen ist nun mal nicht das, worum es mir beim Schreiben heute geht. Mich von der Neigung zum Künden zu befreien hat Arbeit gemacht.
Wittstock: Sie sind kein religiöser Schriftsteller. Ihre Literatur lebt viel eher aus der Skepsis und Ironie. Dennoch macht Ihr Held in dem Roman eine spirituelle Erfahrung. Ist es Ihnen schwergefallen, das zu beschreiben?
Eugen Ruge: Es ist überhaupt schwer, über spirituelle Erfahrungen zu reden. Sobald man darüber spricht, werden diese Erfahrungen verfälscht und beschädigt. Man kann aber behutsam von ihnen erzählen und sie dem Leser gleichsam vor Augen stellen. Man schreibt sozusagen am Rand einer spirituellen Erfahrung entlang und lässt so ihre Kontur erkennbar werden. Das Davor und das Danach. Aber die Erfahrung selbst lässt sich, glaube ich, nicht in Worte fassen.
Wittstock: Kein Zufall also, wenn die Reise den Romanhelden in so etwas wie ein Paradies führt.
Eugen Ruge: Natürlich ist das kein Zufall, sondern Teil der erzählerischen Strategie. Mancher Leser könnte vielleicht auf die Idee kommen, ich hätte die Geschichte der Monate in Cabo de Gata genau so erlebt, wie ich sie im Buch aufgeschrieben habe. Aber das stimmt nicht, der Roman ist gebaut: Manches ist erlebt, anderes erfunden, wieder anderes stark bearbeitet, damit es in die Ordnung der Geschichte passt und seinen Ort finden kann. Und natürlich geht man als Erzähler mit einem so großen Wort wie „Paradies“ sehr vorsichtig um, selbst wenn es in der Geschichte nur auf einem Straßenschild am Wegesrand auftaucht. Man denkt gründlich nach, bevor man so ein Wort in einer Geschichte stehen lässt.
Wittstock: Sie betonen, der Roman sei nicht autobiografisch, sondern „gebaut“. Aber zugleich bauen Sie ihn mit einigen Kunstgriffen genau so, dass der Leser regelrecht dazu verführt wird, ihn für autobiografisch zu halten. Warum?
Eugen Ruge: Ich habe zunächst überlegt, die Geschichte in der dritten Person zu schreiben, ich habe den Helden Dorst genannt. Ich habe mich dann doch entschieden, sie in der Ich-Form zu schreiben, weil ich in der Perspektive, genauer gesagt in den Erinnerungen der Figur bleiben wollte. Es gibt keinen Erzähler, der darübersteht und beurteilt, ob das, was der Erzähler erinnert, wahr ist, denn es geht in dieser Geschichte nicht um Wahrheit, sondern um die Frage, wie – und wie intensiv – etwas erlebt worden ist. Aber wenn man eine Geschichte in der Ich-Form schreibt und wenn man sie gut schreibt, glaubt der Leser natürlich, die Geschichte sei autobiografisch. Wenn der Leser das nicht glaubt, dann hat der Autor seinen Ich-Erzähler nicht gut erfunden.
Das Gespräch mit Eugen Ruge entstand am Schauplatz des Buches, im spanischen Cabo de Gata. Es erschien zuerst in Focus-Spezial Die besten Bücher 2013