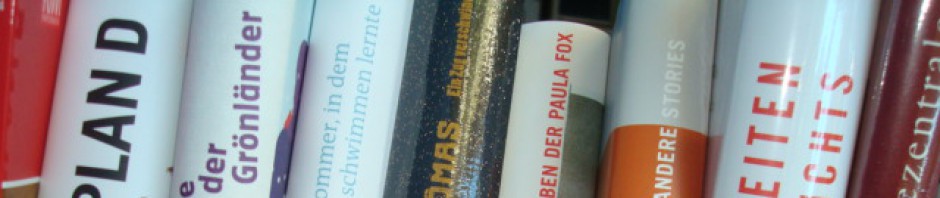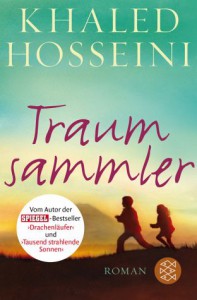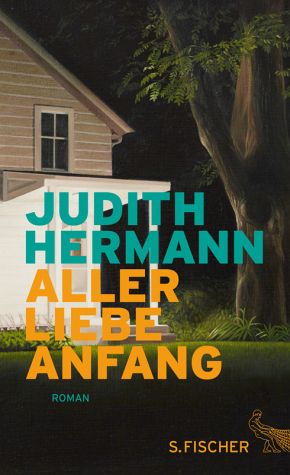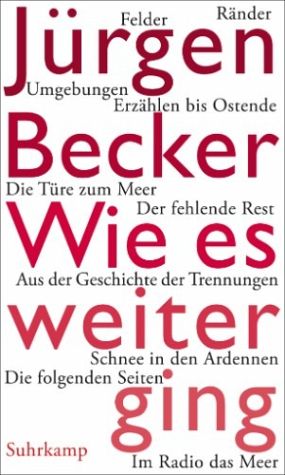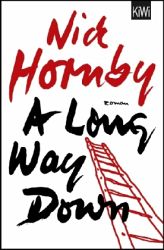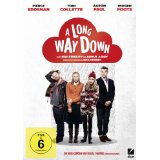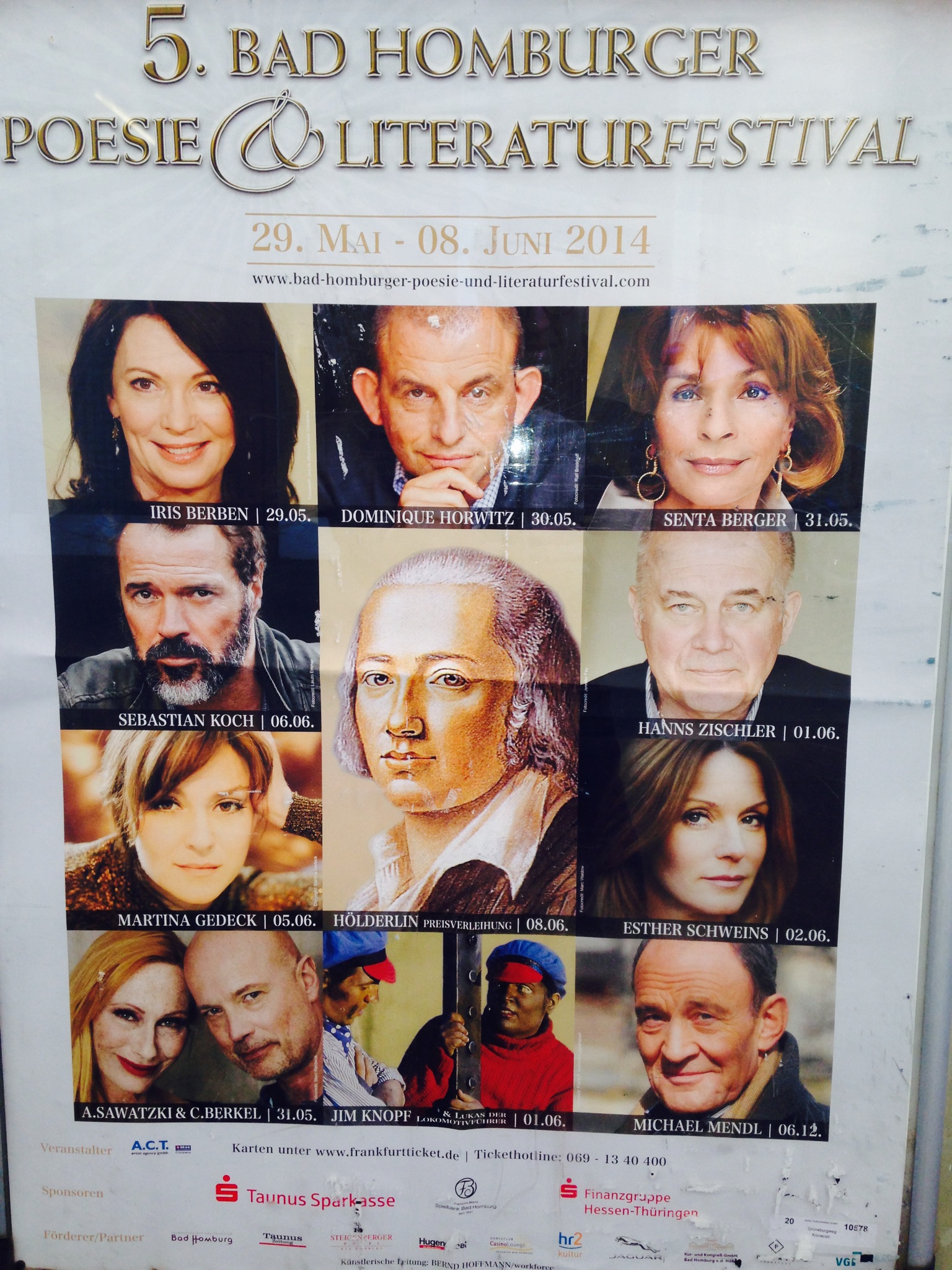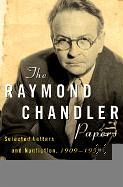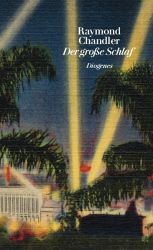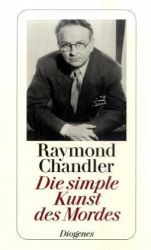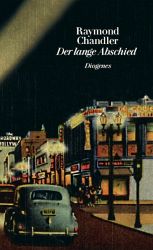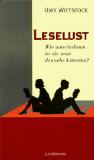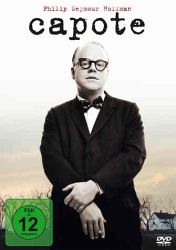“Was und prägt, sind unsere Verluste”
Schon sein Drachenläufer machte ihn berühmt. Doch mit dem neuen Roman Traumsammler erweist sich der afghanisch-amerikanische Schriftsteller Khaled Hosseini als ein Erzähler von Weltrang. Ich hatte Gelegenheit, mit ihm über Geschwisterliebe und elagante Damen in Kabul zu sprechen sowie über das Loch im Dasein. Traumsammler ist jetzt als Taschenbuch erschienen.
Uwe Wittstock: Mr Hosseini, Ihr neuer Roman beginnt mit einer Tragödie: Einer verarmten afghanischen Familie bleibt nichts anderes übrig, als ihre Tochter an ein wohlhabendes Paar in Kabul zu verkaufen. Gab es solche Fälle in Afghanistan?
Khaled Hosseini:Es gab sie, sie sind von Historikern dokumentiert. Als ich davon hörte, sprach ich mit meinem Vater, der 1939 in Kabul geboren wurde. Er hatte dort ähnliche Fälle in den 50er-Jahren erlebt. Ein Mann, den er kannte, war so mittellos, dass er nicht mehr für seinen kleinen Sohn sorgen konnte und ihn deshalb an ein reiches Paar
verkaufen musste. Er liebte ihn, er wollte das Beste für ihn, und die Konsequenz war, dass er ihn zu anderen Menschen weggeben musste. Er hatte zwischen dem Glück für sein Kind und dem eigenen Glück zu wählen. Er entschied sich für das seines Kindes.
Wittstock: In Ihrem Roman bleibt ein Sohn bei seinen verarmten Eltern zurück, und er kann den Schmerz über den Verlust der Schwester nicht verwinden. Er sucht nach ihr sein Leben lang. Haben Sie einen Roman über Geschwisterliebe geschrieben?
Khaled Hosseini: Auch Konkurrenzgefühle zwischen Geschwistern spielen im Roman eine große Rolle. Doch zunächst einmal: Ich setze mich nicht hin mit dem Vorsatz, einen Roman über Geschwistergefühle zu schreiben. Am Anfang stehen die Charaktere, sie entfalten sich, ich bleibe ihnen auf der Spur, folge ihnen behutsam tastend und beobachte, wie sich ihre Geschichte entwickelt. Später dann, auf halbem Weg, schaue ich zurück und merke: Es ist eine Geschichte über Familien oder über Geschwister geworden. Ein Verhältnis zwischen Geschwistern entpuppt sich oft als schwierig: voller Bewunderung, Liebe, Großzügigkeit, aber ebenso gefährdet durch Eifersucht, Reue, Wettbewerb. Das sind sehr widersprüchliche Empfindungen: das perfekte Ausgangsmaterial für große Dramen, die sich auf engstem Raum, wie in einer Nussschale, abspielen.
Wittstock: Sie begegneten den Vorbildern für die Roman-Geschwister in Afghanistan?
Khaled Hosseini: Im Herbst 2009 traf ich in Afghanistan zwei kleine Schwestern, vier und sieben Jahre alt. Sie waren auffallend schön, hatten blondes Haar, tiefblaue Augen, helle Haut. Ihre Familie kam aus dem Norden, sie lebte in einer abgelegenen Steppe, nur steinige Berge ringsum, die Regierung hatte ihnen dort ein kleines Stück Land gegeben. Sie lebten in einer Art Schuppen mitten im nirgendwo. Die beiden Mädchen gingen ungeheuer liebevoll miteinander um, sie hatten offensichtlich eine tiefe Verbindung. Sie besaßen nur ein Spielzeug, einen kleinen Plastikbären, und eine Schaukel an dem Ast des einzigen Baumes weit und breit. Der Gegensatz zwischen der abweisenden Landschaft und der Schönheit der Kinder und ihrer Zärtlichkeit füreinander machte einen tiefen Eindruck auf mich. Dann dachte ich darüber nach, was es für sie bedeuten würde, getrennt zu werden. Das war der Anfang des Romans.
Wittstock: Die Frau in Kabul namens Nila, die das Mädchen aufnimmt, ist eine moderne, westliche Frau. Sie schreibt Gedichte, sie flirtet mit ihrem Chauffeur, sie betrügt ihren Ehemann. War Afghanistan damals ein Land extremer kultureller Gegensätze?
Khaled Hosseini: In bin in den 60er- und 70er-Jahren in Kabul aufgewachsen. Damals gehörte Afghanistan zu den Schauplätzen, auf denen der Kalte Krieg besonders heftig ausgetragen wurde. In einer bestimmten Schicht der Gesellschaft Kabuls war der westliche Einfluss sehr stark. Es gab mondäne Partys, elegant gekleidete Frauen, die Alkohol tranken und Zigaretten rauchten. Sie studierten oder lehrten an der Universität, hielten mit ihren Ansichten nicht zurück und flirteten ungeniert mit Männern. Erst wenn man dieses Milieu kennt, begreift man, wie sehr sich Afghanistan inzwischen verändert hat. Alles das fließt zusammen in der Figur der Dichterin Nila, meiner Lieblingsfigur in diesem Roman. Sie ist so voller Geheimnisse und Widersprüche, eine sinnliche Frau, die sich nicht scheut, über ihre sexuellen Bedürfnisse zu schreiben. Und die keinen Pfifferling darauf gibt, wie eine Frau sich angeblich in der Öffentlichkeit zu verhalten habe.
Wittstock: Nila sagt, Schriftsteller lebten davon, das Schicksal anderer Menschen in ihren Büchern auszubeuten. Stimmen Sie ihr zu?
Khaled Hosseini: Ja, ich stimme ihr zu. Das ist nicht schön, aber man muss es sich eingestehen: Wir Schriftsteller werden inspiriert durch das, was wir beobachten und erleben. Sobald wir nicht ausschließlich über uns selbst schreiben, plündern wir das Leben anderer. Wir leihen uns hier einen Charakterzug, dort ein paar biografische Details und bauen daraus unsere Figur zusammen. Es hat etwas von Raub, denn wir fragen ja nicht um Erlaubnis. Aber das gehört zur literarischen Arbeit, es geht nicht anders.
Wittstock: Es tritt auch ein afghanischer Warlord auf, der für üble Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird, den die Menschen des von ihm beherrschten Landstrichs aber dennoch als ihren Wohltäter und Patriarchen betrachten.
Khaled Hosseini: Ja, das ist ein sehr ambivalenter Charakter. Solche Menschen gibt es, nebenbei gesagt, nicht nur in Afghanistan, sondern überall auf der Welt. Dieser Warlord hat große Schuld auf sich geladen, aber er ist ein Segen für seine Leute: Er hat eine Klinik gebaut, in der auch Frauen behandelt werden, er hat Schulen gegründet, in die auch die Mädchen gehen dürfen. Beide Aspekte dieser Figur zusammen charakterisieren das Verhältnis, das viele Afghanen zu ihren Warlords haben: Sie fürchten sie, aber bewundern und respektieren sie auch oder lieben sie sogar.
Wittstock: Es gibt eine Gemeinsamkeit fast all ihrer Romanhelden: Sie vermissen einen geliebten Menschen.
Khaled Hosseini: Verlust ist ein wichtiger Aspekt des Lebens. Oft sind es die Verluste, die uns prägen und vorantreiben. In jedem Leben fehlt etwas, fast alle Menschen sind auf der Suche: nach Liebe, Hoffnung, Wohlstand, Würde, Schönheit. Und wir alle versuchen das, was uns fehlt, wiederzufinden oder zu ersetzen – in welchem indirekten oder metaphorischen Sinne auch immer. Davon will ich in meinem Roman erzählen: von dem Schmerz der Trennung und der Sehnsucht nach Wiedervereinigung. Meine Figuren leben ihr Leben in dem Bewusstsein, dass es da ein Loch in der Mitte ihres Daseins gibt – und sie versuchen es, jede auf ihre Weise, so gut es geht zu füllen. Irgendwie gelingt ihnen das auch, aber anders, als sie es gewollt oder erwartet hätten.
Wittstock: Sie nutzen für Ihren Roman ganz unterschiedliche Formen des Erzählens: Es gibt Kapitel in der Tonlage eines Märchens, es gibt Briefe oder Interviews.
Khaled Hosseini: Die Geschichte des Romans überspannt Jahrzehnte. Ich musste Formen finden, die sich einerseits ganz natürlich in die Erzählung einfügen, die es mir aber andererseits möglich machen, die zeitlich so ausgedehnte Handlung zu raffen. Das Interview zum Beispiel gibt mir die Möglichkeit, in knapper Form viel über Nilas Lebensweg zu erzählen und den Leser zugleich einen tiefen Blick in ihre sonst verborgenen Gedanken werfen zu lassen.
Wittstock: Ihre vorangegangenen Bücher waren Welt-
erfolge. Hat Sie das bei der Arbeit an Ihrem neuen Roman unter Druck gesetzt?
Khaled Hosseini: Nein. Ich fühle mich zwar unter Druck bei der Arbeit an einem neuen Buch, aber nicht durch die Fragen nach dem möglichen Erfolg. Der Druck entsteht durch die Frage: Habe ich wirklich etwas zu sagen? Habe ich eine Geschichte, die sich zu erzählen lohnt? Am meisten fürchte ich den Augenblick, in dem ich vor dem Computer sitze und das Gefühl habe, mir fällt nichts mehr ein. Vielleicht wird irgendwann der Tag kommen, an dem ich feststellen muss, meine Quelle ist ausgetrocknet. Diese Vorstellung ist es, die mich unter Druck setzt. Alles andere, einschließlich der Frage, ob das Buch ein Erfolg wird, ist verglichen damit allenfalls ein Hintergrundgeräusch, das ich ganz und gar ausblende, um mich auf meine Geschichte zu konzentrieren.