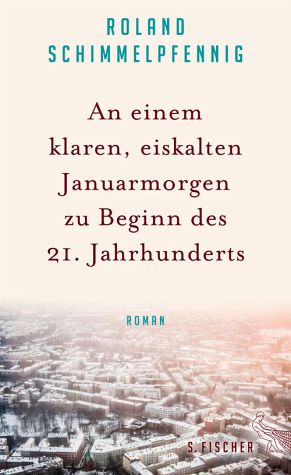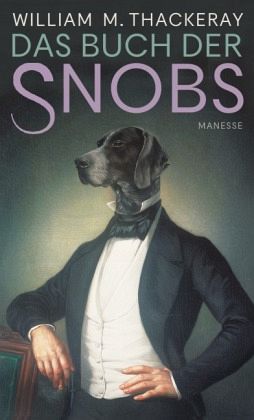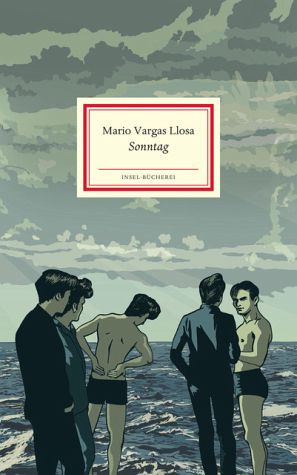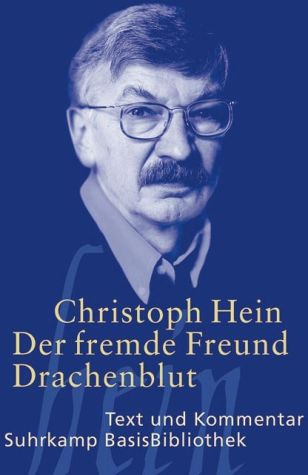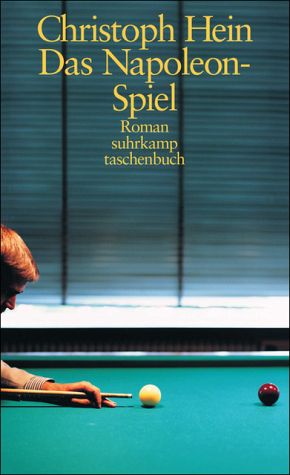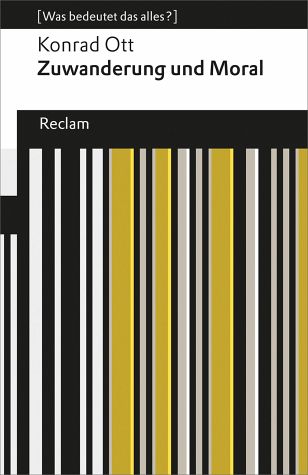Miguel de Cervantes und William Shakespeare oder: Was mit Rittern und so…
Als rasendem investigativen Literaturreporter fiel mir die Aufzeichnung einer bislang noch nicht gesendeten Talk-Show aus Anlass des 400. Todestages von Miguel de Cervantes und William Shakespeare in die Hände. Sensationelles Material, denn die Gäste dieser Talk-Show sind drei der besten und bekanntesten Schriftsteller der deutschen Literaturgeschichte: Goethe, Heinrich Heine und Thomas Mann! Ich zögere natürlich nicht, diesen hoch brisanten Beitrag zur Fernsehkultur hier zu leaken und damit nachträglich dem Jubiläum und der beiden Schriftsteller zu gedenken. Die Abschrift folgt, ganz großes Ehrenwort, Wort für Wort der Aufzeichnung.
Wir befinden uns in einem Fernsehstudio mit vier schweren Ledersesseln. Der Moderator, so um die Dreißig, geht an den Kameras vorbei auf den letzten freien Sessel zu und begrüßt die Zuschauer seiner Talk-Show:
Moderator: Hallo Leute! Vor 400 Jahren hatte die Literatur einen echt superschwarzen Tag. Am 23. April 1616 gingen gleich zwei der größten Dichter aller Zeiten in die ewigen Jagdgründe der Poesie ein: Miguel de Cervantes und William Shakespeare. Der eine hat den Bestseller „Don Quijote“ geschrieben, mit Rittern und so, der andere lauter Theaterstücke. Manche auch mit Rittern. Um über die beiden alten Knaben zu reden, haben wir drei supertolle Schriftsteller eingeladen: äh… (liest von seinen Notizen ab) Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Heinrich Heine (1797-1856) und Thomas Mann (1875-1955)…
Thomas Mann (unterbricht): Verzeihen Sie, junger Mann, eine winzige Korrektur, die Sie mir wohl nachsehen wollen: Cervantes Stunde schlug am 23. April nach dem gregorianischen Kalender – und damit zehn Tage vor der Shakespeares, der am 23. April nach dem julianischen Kalender starb. Wenn es also nur die Koinzidenz der Daten war, die Sie unseren kleinen Gesprächszirkel einberufen ließ, sollten wir die Runde rasch aufheben.
(Goethe, Heine, Mann stehen auf, wollen das Studio verlassen)
Moderator (verdattert): Also nein… Sie können doch nicht … Wir sind live!
Johann Wolfgang von Goethe: Live?
Moderator: Ja, Millionen schauen uns zu! Jetzt! Millionen, die Ihre Bücher in der Schule gelesen haben.
Heinrich Heine: In der Schule? Die Ärmsten.
(Goethe, Heine, Mann lassen sich wieder in ihre Sessel fallen.)

Es gibt leider kein gesichertes Porträt von Cervantes. Es wird aber allgemein angenommen, dass dieses Porträt Cervantes zeigt
Moderator (erleichtert): Herr Goethe. Stichwort: Theater. Sie haben ja auch Stücke geschrieben. Mit Rittern oder so. Da war Shakespeare bestimmt eine Super-Inspiration für Sie?
Goethe: Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf Zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stund ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt.
Moderator: Das Gesicht?
Heine: Geheimrat Goethe meint: Augen, Sehkraft! Sie Schwachkopf.
Moderator: Ach so. Und Cervantes? Hat der Sie auch dermaßen umgehauen?
Goethe: Ich habe an den Novellen des Cervantes einen wahren Schatz gefunden, sowohl der Unterhaltung als der Belehrung. Wie sehr freut man sich, wenn man das anerkannte Gute auch anerkennen kann.
Mann (zum Moderator): Sie sollten, junger Mann, nicht übersehen, welch bedeutende Verknüpfung zwischen dem Dichter eines Abenteuers wie Don Quijote und dem unsterblichen Barden der Briten besteht: Denn es gilt zu bedenken, dass Shakespeare nur auf unvergleichlich geniale Weise tat, was vor ihm viele auf eine sehr simple und mechanische Weise getan hatten. Das Drama entstand, indem man den von Handlung wuchernden Abenteuerroman für die leibliche Vorstellung auf der Schaubühne übersetzte.
Heine: Der Spaniern gebührt der Ruhm, den besten Roman hervorgebracht zu haben, wie man den Engländern den Ruhm zusprechen muss, dass sie im Drama das Höchste geleistet. Und den Deutschen, welche Palme bleibt ihnen übrig? Nun, wir sind die besten Liebesdichter dieser Erde. Cervantes, Shakespeare und Goethe bilden das Dichtertriumvirat, das in den drei Gattungen poetischer Darstellung, im Epischen, Dramatischen und Lyrischen, das Höchste hervorgebracht.
(Heine nickt Goethe zu, Goethe erwidert das Nicken huldvoll)
Moderator: Die TopDrei der Literaturgeschichte! Super! Ich hab vor der Sendung mal reingelesen in diesen „Don Quijote“. Ist ja mehr so ein Mittelalter-Nerd als ein Ritter. Was ist so toll an ihm, Herr Mann?
Mann: Das Buch zeigt, wie aus bescheidener Konzeption, einer lustig lebensgesegneten Satire, bei welcher der Dichter sich ursprünglich nicht viel gedacht hat, ein Volks- und Menschheitsbuch wird. Don Quijote ist zwar närrisch, doch nicht im mindesten unklug, was freilich der Dichter selbst im voraus nicht so recht gewusst hat. Seine Achtung vor dem Geschöpf seiner eigenen komischen Erfindung ist während der Erzählung ständig im Wachsen, – dieser Prozess ist vielleicht das Fesselndste am ganzen Roman.
Moderator: Was? Dieser Cervantes hat erst beim Schreiben kapiert, sie super sein Don Quijote ist? Echt wahr? Aber Shakespeare, the King of Drama, hatte seine Figuren besser Griff?
Heine: Im Gegenteil. Der große Brite ist nicht bloß Dichter, sondern auch Historiker. Die Aufgabe Shakespeares war nicht bloß die Poesie, sondern auch die Geschichte. Er konnte die gegebenen Stoffe nicht willkürlich modeln, er konnte nicht die Ereignisse und Charaktere nach Laune gestalten. Dennoch: In dieses Geschichtsdramen strömt die Poesie reichlicher und gewaltiger und süßer als in den Tragödien jener Dichter, die ihre Fabeln entweder selbst erfinden oder nach Gutdünken umarbeiten.
Mann: Shakespeare, das ist der ungeheuerste Fall von Dichtertum, den die Erde sah. So besaß er ohne Zweifel, wie er alles besaß, auch Erfindung. Aber noch sicherer ist, dass er nicht viel Gewicht darauf legte und nicht viel Gebrauch davon machte. Hat er je eine Fabel erfunden? Auch die krausen Intrigen seiner Lustspiele sind nicht von ihm erdacht. Er arbeitete nach alten Theaterstücken, nach italienischen Novellen. Er fand viel lieber, als dass er erfand
Moderator: Klar, super Typ, dieser Shakespeare. Aber übertreiben Sie nicht? Es gibt jede Menge Fehler in seinen Stücken. Können Sie mal bei Wikipedia nachlesen. (schaut triumphierend)
Mann: Wiki… Wer bitte?
Heine (wütend): Überall Kleinigkeitskrämerei, selbstbespiegelnde Seichtigkeit, gelehrter Aufgeblasenheit, die vor Wonne fast zu platzen droht, wenn sie dem armen Dichter irgendeinen antiquarischen, geographischen oder chronologischen Schnitzer nachweisen.
Goethe: Niemand hat das materielle Kostüm mehr verachtet als Shakespeare. Er kennt recht gut das innere Menschenkostüm, und hier gleichen sich alle. Man sagt, er habe die Römer vortrefflich dargestellt. Ich finde es nicht. Es sind lauter eingefleischte Engländer. Aber freilich Menschen sind es, Menschen von Grund aus, und denen passt wohl auch die römische Toga. Hat man sich einmal hierauf eingerichtet, so findet man seine Anachronismen höchst lobenswürdig, und gerade dass er gegen das äußere Kostüm verstößt, das ist es, was seine Werke so lebendig macht.
Moderator: Also echt Leute, das sollen die Größten in eurem Gewerbe sein? Der eine kapiert erst beim Schreiben, was er schreibt. Der andere wird für seine Fehler gelobt?
Mann: Junger Mann, Ihr Vorwurf lässt Ihre Ahnungslosigkeit erkennen. Man muss an dieser Stelle begreifen, dass es eine objektive Erkenntnis im Reiche der Kunst überhaupt nicht gibt, sondern nur eine intuitive.
Heine (fixiert den Moderator): Natürlich verzeihe ich meinen Feinden. Aber erst an dem Tag, an dem ich sie hängen sehe.
Mann (fixiert den Moderator): Vergessen Sie nicht junger Mann: Ein Künstler muss in derselben Verfassung an sein Werk gehen, in der der Verbrecher seine Tat begeht.
Goethe (fixiert den Moderator): Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent.
Moderator (schwitzt, seine Karteikarten fallen ihm aus der Hand, hektisch): Vielen Dank, ich freue mich, dass Sie in unserer Sendung waren.
Bei Abschrift der Sendung fiel mir auf, dass die Herren Goethe, Heine, Mann in ihren Antworten wörtlich auf Gedanken ihrer Essays zurückgriffen. Um die übernommenen Sätze kenntlich zu machen, haben ich die Zitate kursiv gedruckt.
Aufgezeichnet von Uwe Wittstock