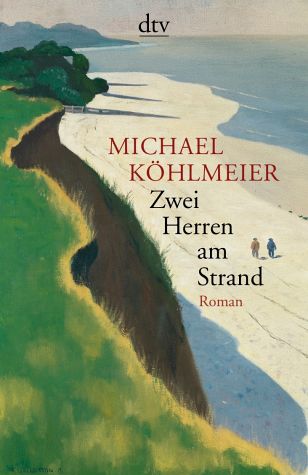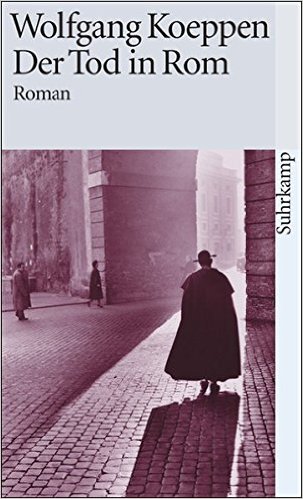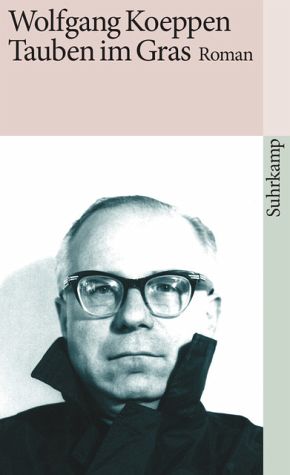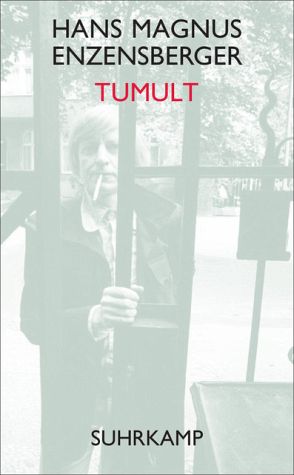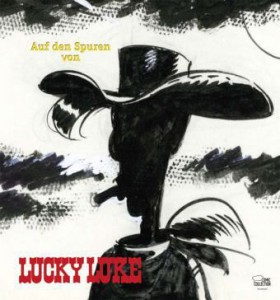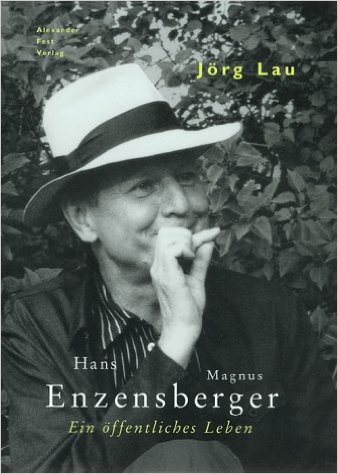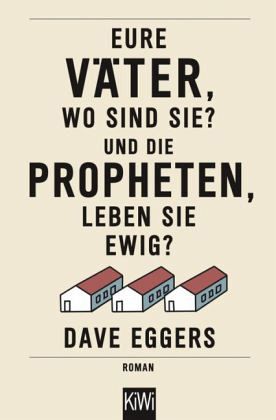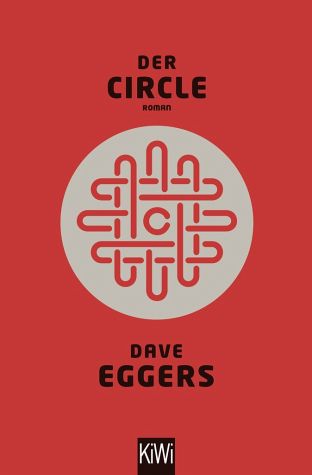“Koeppens entscheidendes Buch ist im falschen Augenblick erschienen. Viel zu früh!”
Vor zehn Jahren wurde Wolfgang Koeppens 100. Geburtstag gefeiert. Damals war das für mich ein Anlass, mit Marcel Reich-Ranicki über diesen Meister des Verträumens und Versäumens zu sprechen, schließlich hatte sich MRR für ihn hartnäckig und über Jahre hinweg eingesetzt – allerdings ohne den durchschlagenden Erfolg bei den Lesern, den Reich-Ranicki sonst von sich gewohnt war. Er zählte Koeppen zu den wichtigsten Schriftstellern der deutschen Nachkriegsliteratur. Weshalb Koeppen dennoch nur ein recht kleines Publikum findet, ist m.E. auch heute noch, an Koeppens 110. Geburtstag, ein paar Überlegungen wert.
Uwe Wittstock: Für keinen anderen Schriftsteller haben Sie sich so hartnäckig eingesetzt wie für Wolfgang Koeppen. Heute gehört er unverändert zu den wenig gelesenen deutschen Nachkriegsautoren. Ist Koeppen für Sie als Literaturvermittler eine große Niederlage?
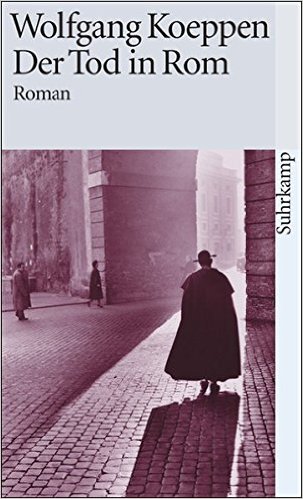
Wolfgang Koeppen: "Tod in Rom". Suhrkamp, 9 Euro
Marcel Reich-Ranicki: Nein. Aber ein Sieg oder ein Triumph war es nun auch nicht. Das erste Buch von Koeppen las ich Mitte der fünfziger Jahre noch in Polen, den Roman “Tod in Rom”. Nachdem ich die frühen Bücher von Böll, Walser oder Siegfried Lenz gelesen hatte, erschien mir Koeppen damals der modernste unter den neueren deutschen Schriftstellern zu sein. Damit begann meine Begeisterung für ihn, ich war entschlossen, seine öffentliche Wirkung nach Kräften zu fördern. Nicht primär, um Koeppen zu unterstützen, sondern weil ich glaubte, daß es für die deutsche Literatur wichtig sei, einem so modernen Erzähler zum Erfolg zu verhelfen.
Wittstock: Was erschien Ihnen damals so originell an Koeppen?
Marcel Reich-Ranicki: Die deutsche Literatur nach 1945 stand insofern unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, als sie sich vor allem gegen Geist und Sprache des Dritten Reiches wendete. Die Autoren, die damals ihre Karriere begannen, Wolfgang Borchert, Böll, Schnurre, später Lenz schrieben im Grunde eher konventionelle Literatur, die an den Expressionismus anknüpfte oder unter dem Stichwort “Kahlschlag” firmierte: Sie kämpften gegen jedes Pathos, jeden Schwulst, noch einfacher gesagt: gegen die großen Worte, die von den Nazis mißbraucht worden waren. Hinzu kam der lapidare, lakonische Stil Hemingways, der viele Autoren damals beeinflußte. Mit all dem hatte Koeppen nichts zu tun. Er knüpfte an andere Vorbilder an, an Joyce, Dos Passos, Faulkner, Proust und Döblin. Diese Tradition moderner Prosa in Deutschland wieder zu stärken, schien mir sehr wichtig.
Wittstock: Aus heutiger Sicht wirkt manches an Koeppens Romanen gar nicht modern, sondern recht kolportagehaft.
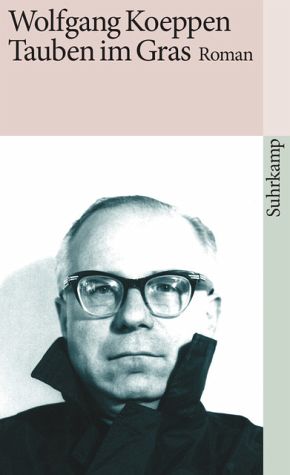
Wolfgang Koeppen: "Tauben im Gras". Suhrkamp, 8 Euro
Marcel Reich-Ranicki: Gewisse kolportagehafte Elemente finden Sie in fast jedem Roman. Und Koeppens Romane sind von unterschiedlicher Qualität. Keine Frage, sein bedeutendstes Buch ist “Tauben im Gras”. An diesem Roman ist nichts kolportagehaft, das ist große Literatur. Etwas schwächer sind “Tod in Rom” und “Das Treibhaus”.
Wittstock: War Koeppen für Sie nicht auch eine Gegenfigur zu Arno Schmidt? Wenn Sie Koeppen für die Modernität seiner Prosa loben, dafür, daß er sich an Dos Passos und Joyce geschult hat, trifft das doch in vielleicht noch höherem Maße auf Schmidt zu?
Marcel Reich-Ranicki Ich habe mich viel mit Schmidt beschäftigt. Ich bewundere einige seiner Erzählungen, zumal “Seelandschaft mit Pocahontas” und “Die Umsiedler”. Beide habe ich in meinen Kanon aufgenommen. Seine Romane haben mich allerdings nie ganz überzeugt, sie sind oft blutleer. Es ist aber richtig, daß Schmidt in mancherlei Hinsicht einen ähnlichen Weg wie Koeppen gegangen ist. Aber weder Schmidt noch Koeppen haben einen großen Einfluß auf die deutsche Literatur der fünfziger und sechziger Jahre gehabt.
Wittstock: Bleiben wir bei Koeppen: Warum hatte er trotz seiner Modernität und Ihres Engagements für ihn so wenig Erfolg?
Marcel Reich-Ranicki: Sein entscheidendes Buch, “Tauben im Gras”, war im falschen Augenblick erschienen. Es kam 1951 viel zu früh. Das Publikum war weder bereit noch fähig, diese Literatur zu akzeptieren. Joyce war ja damals in der Bundesrepublik nahezu unbekannt, Dos Passos nie populär gewesen oder schon wieder vergessen, und Faulkner setzte sich gerade erst langsam durch. Die Deutschen waren durch die Nazis zwölf Jahre lang von der modernen Literatur abgeschnitten gewesen. Die Leser hatten kein Verständnis für Koeppen, er wirkte allzu avantgardistisch auf sie.
Wittstock: Tatsächlich?
Marcel Reich-Ranicki: Ja, das war so. Viele Leute, die ich persönlich kenne, haben auf meine Empfehlung hin “Tauben im Gras” gelesen. Und nach fünf oder zehn Seiten klappten die das Buch zu und sagten: “Ich verstehe das nicht.” Dabei sind die ersten Seiten des Buches besonders gut geschrieben – aber sie sind nicht leicht zugänglich.
Wittstock : Koeppens Roman “Tauben im Gras” wurde vorgeworfen, lebende Zeitgenossen so genau zu porträtieren, daß diese sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen könnten. Er hat darauf in seinem Aufsatz “Die elenden Skribenten” geantwortet. Hat dieser Vorwurf Koeppens Roman damals geschadet?
Marcel Reich-Ranicki: Ich glaube nicht. Damals protestierten Leute gegen “Tauben im Gras” und behaupteten, Koeppen habe ihr Leben in dem Buch dargestellt. Doch er kannte diese Leute überhaupt nicht. Er sagte einmal zu mir, er sei verblüfft gewesen, wie viele Menschen genau jene Gefühle zu teilen schienen, die er in seinem Roman beschrieben hatte: diese Angst, dieses Leiden an der Nachkriegszeit. Er hatte sie offensichtlich genau getroffen. Ein großer Triumph für einen Schriftsteller.

Wolfgang Koeppen: "Das Treibhaus". Suhrkamp, 8,50 Euro
Wittstock: Gibt es nicht noch einfache Gründe dafür, daß Koeppen wenig Erfolg hatte? Im “Treibhaus” macht er einen Bundestagsabgeordneten zur Hauptfigur, der sich als pädophiler sozialistischer Selbstmörder entpuppt. Ist es wirklich eine Überraschung, daß dieses Buch kein Massenerfolg war?
Marcel Reich-Ranick: Nein, das ist keine Überraschung. Der Held verführt gleich nach dem Krieg ein sechzehnjähriges Mädchen – das ist, wie so vieles in den Romanen Koeppens, natürlich autobiographisch. Literatur ist doch meist Selbstdarstellung.
Wittstock: Die Hauptfigur ist sehr eindrucksvoll, aber nicht eben eine, mit der sich viele Leser gern identifizieren würden.
Marcel Reich-Ranicki: Ich habe den Eindruck, daß Koeppen “Treibhaus” viel zu schnell geschrieben hat. Das Buch ist streckenweise flüchtig. Dann kommt hinzu: Das Milieu war zuvor noch nie dargestellt worden. Noch kein anderer hatte die politische Welt in Bonn, das Parlament, die Parteien, die Fraktionen, die Bundestagsabgeordneten zum Thema der Literatur gemacht. Es gab also keine Vorbilder. Trotzdem hätte Koeppen das noch besser schaffen können, wenn er der Sache mehr Zeit gewidmet hätte.
Wittstock: Ist “Tauben im Gras” wirklich einer der wichtigsten Romane der deutschen Nachkriegsliteratur?
Marcel Reich-Ranicki: Es ist künstlerisch der beste deutsche Roman dieser Zeit und dieser Generation. Von Arno Schmidt war schon die Rede. Seine Romane scheinen mir doch alle etwas blutleer zu sein. Uwe Johnsohn ist im Kanon selbstverständlich enthalten (eine Erzählung, ein Essay), aber ein Roman wie “Mußmaßungen über Jakob” scheint mir für die Leser doch zu schwer. Die beiden Romane von Jurek Becker und Patrick Süskind waren für den Kanon vorgesehen, mußten aber der grausamen Umfanggrenze zum Opfer fallen.
Wittstock: In einem der Briefe an Siegfried Unseld beschwert sich Wolfgang Koeppen massiv über Sie: “Reich-Ranicki, gefährlich gekränkt, begreift überhaupt nichts, hat kein Empfinden für Sätze, die nicht in seine Erwartungen passen, er mißversteht erfreut und rührt im Literaturklatsch, er liest nicht, sucht eine Wunde, steckt die Hand hinein und reißt auf zum Schlachtfest.” Haben Sie mit solchen Äußerungen Koeppens gegen Sie gerechnet, obwohl sie sich so für ihn einsetzten?
Marcel Reich-Ranicki: Nein. Ich habe damals, als das geschrieben wurde, noch nicht gewußt, was ich später gelernt habe: Die Autoren wollen meist doch nur gelobt werden. Und werden sie nicht gelobt, behaupten sie immer, der Kritiker sei gefährlich gekränkt, begreife überhaupt nichts und habe kein Empfinden für Sätze.
Wittstock: Aber Sie haben Koeppen gelobt.
Marcel Reich-Ranicki: Nein. Diesen Brief schickte er an Unseld, nachdem ich über sein Buch “Romanisches Café” geschrieben hatte, es sei ein Sammelband mit alten Arbeiten, der auch einige “ziemlich schwache Stücke, flüchtige oder nebensächliche Gelegenheitsarbeiten” enthalte. Das hat mir Koeppen verübelt.
Wittstock: Sie sind ein sehr temperamentvoller, aktiver Mensch. Koeppen dagegen war ein großer Meister des Verträumens und Versäumens. Wie sind Sie mit seiner Neigung zur Trägheit, zur Passivität zurechtgekommen?
Marcel Reich-Ranicki: Schlecht. Ich hatte gehofft, ihn zum Schreiben zu bringen. Und es ist mir auch gelungen, in sehr bescheidenen Grenzen. Also habe ich ihm immer wieder Aufträge gegeben, Bücher des 19. Jahrhunderts für die FAZ zu rezensieren. Manche dieser Bücher habe ich überhaupt nur besprechen lassen, damit er Aufträge erhielt. Aus diesen Artikeln ist dann Koeppens Buch “Die elenden Skribenten” entstanden. Ich glaube, es ist ein wichtiges Buch, aber natürlich kein Ersatz für den Roman, den ich von ihm zu bekommen hoffte.
Wittstock: In Ihrer Autobiographie “Mein Leben” nennen Sie Ihren Vater einen “willensschwachen Menschen” von “erschreckender Untüchtigkeit” und kritisieren seine “Passivität”. Die Beschreibung könnte ebensogut auf Koeppen passen. War der eine halbe Generation ältere Koeppen für Sie auch so etwas wie eine Erinnerung an Ihren Vater? Und haben Sie sich deshalb so hartnäckig für diese Vaterfigur eingesetzt?
Marcel Reich-Ranicki: Nicht im geringsten. Die Ähnlichkeiten, von denen Sie sprechen, waren mir nicht bewußt – weder als ich Koeppen zu fördern versuchte, noch als ich das Buch “Mein Leben” schrieb. Aber ich verstehe, daß sie heute darauf hinweisen.
Wittstock: Könnte es sein, daß Wolfgang Koeppen Sie unbewußt an Ihren Vater erinnert hat?
Marcel Reich-Ranicki: Ja.