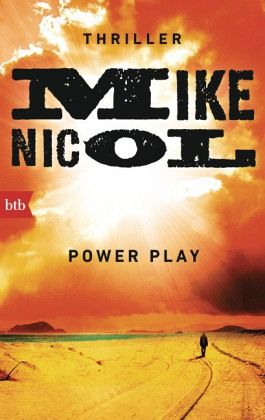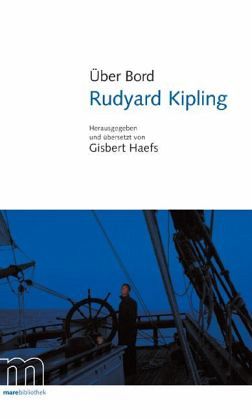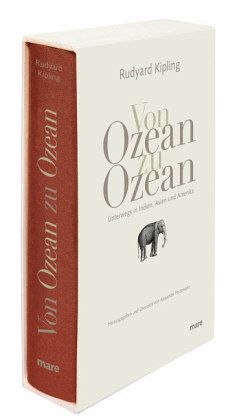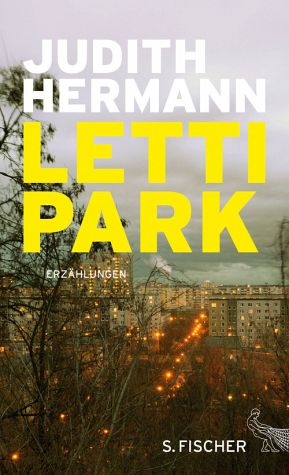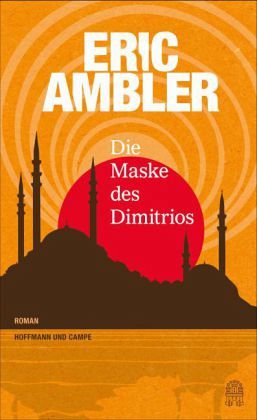»Fahr zur Olympiade und hol Gold«
Kürzlich war der 105. Geburtstag von Max Frisch zu feiern. Sein Sohn Peter Frisch ist Segelsportler und als Händler von Segelzubehör ein erfolgreicher Unternehmer in München. Ich sprach mit ihm über seinen Vater, dessen Wunsch etwas Großes zu machen und etwas Besonderes zu sein sowie darüber, wie es der Sohn lernte sich aus dem Schatten des berühmten Vaters zu befreien.
Uwe Wittstock: Was ist Ihre früheste Erinnerung an Max Frisch?
Peter Frisch: Das Klappern seiner Schreibmaschine oben in der Mansarde über unserer Wohnung. Und der Kran, den er aus dem Märklin-Baukasten mit mir zusammen baute. Das konnte er sehr gut – da merkte man den Architekten.
Wittstock: Es heißt, Ihr Vater hat Ihnen das Segeln beigebracht. Stimmt das?
Peter Frisch: Ja, aber er war kein großer Segler. Er nahm mich ab und zu mit dem Boot eines Freundes mit auf den Zürichsee. Erst hat er mir das Prinzip des Segelns an einem kleinen Modell erklärt. Das konnte er gut. Ich habe das später bei meinen Kindern auch so gemacht, das ist gar nicht so leicht. Aber beim praktischen Segeln, bei der Bedienung des Bootes, war mein Vater nur mäßig.
Wittstock: War das Segeln so etwas wie die verbindende Gemeinsamkeit zwischen Vater und Sohn?
Peter Frisch: Nein, das nicht. Sicher, er hat mit mir bei einem Urlaub auf Sylt mal ein Boot gebastelt, ganz primitiv, aus einem Brett und einer Handtuchstange. Es kippte sofort um und war nicht zu gebrauchen. Am Segeln interessierte ihn das Meer, die Weite, das Offene. Verbunden hat uns das Segeln nicht, eher im Gegenteil: Er fand das seltsam, dass der Sohn so viel segeln geht und nichts Gescheites macht. Als ich ihm erklärte, Segeln sei mein Sport, meinte er: Gut, dann fährst du zur Olympiade und holst die Goldmedaille. Er hatte sehr hohe Ansprüche. Was man macht, musste man in seinem Augen ganz und gar machen.
Wittstock: Sie wurden tatsächlich ein exzellenter Segler: 1976 Deutscher Meister im Flying Dutchman.
Peter Frisch: Das ist immer die Frage nach den Maßstäben. Ich war ganz gut, aber nicht gut genug, um ein Leben, einen Beruf darauf aufzubauen. Eine Goldmedaille habe ich nicht gewonnen.
Wittstock: Was sagte Ihr Vater, als Sie Deutscher Meister wurden?
Peter Frisch: Ich bin mir nicht sicher, ob er dazu viel gesagt hat. Der Titel fiel in eine schwierige Zeit unseres Verhältnisses. Er war ja nicht der große Kinder-Vater. Seine Hauptsorge war: Macht der Junge was Vernünftiges, etwas, von dem er leben kann? Als ich dann Segelzubehör zu verkaufen begann, sah er das nur als kleines Zubrot. Das war es zu Anfang auch. Er hatte in seinem Beruf das höchste Niveau erreicht, und er wollte, dass ich in meinem genauso viel erreiche.
Wittstock: Sie haben – wie Ihr Vater und Ihr Großvater – Architektur studiert.
Peter Frisch: Und jetzt studiert mein Sohn ebenfalls Architektur: An der ETH Zürich, wie sein Großvater Max.
Wittstock: Eine Architekten-Dynastie. Warum entschieden Sie sich für die Architektur?
Peter Frisch: Meine Mutter war ja auch Architektin. Ich war oft im Büro meines Vaters, sah seine Entwürfe, ging mit ihm auf die Baustellen. Die Arbeit begann mich zu interessieren, und sie hat ja auch etwas sehr Schönes: Man sitzt vor einem weißen Blatt Papier, man weiß, was entstehen soll, und muss dafür die beste und attraktivste Form finden.
Wittstock: Klingt wie die Arbeit eines Schriftstellers.
Peter Frisch: Kreativität gibt es ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf dem leeren Blatt kann ein Roman entstehen, ein Haus oder ein Marketingkonzept. Bei all dem geht es darum, sich etwas Komplexes auszudenken, das in sich stimmig und hoffentlich schön ist und das die Menschen überzeugt. Die Architektur ist dafür eine gute Schule.
Wittstock: Was sagte Ihr Vater, als Sie sich entschieden, Ihren Beruf als Architekt aufzugeben?
Peter Frisch: Das war eine ziemliche Enttäuschung für ihn. Er glaubte nicht, dass ich aus meiner kleinen Segelfirma etwas Richtiges machen könnte, etwas, das über das reine Geldverdienen hinausging. Eine Sache richtig zu machen, etwas Großes zu machen und deshalb etwas Besonderes zu sein, stand für ihn immer im Mittelpunkt. Geld war für ihn eher unwichtig. Wenn er mit seiner Arbeit Geld verdiente, dann hat er das gern genommen, aber das war nicht das Entscheidende. Seine Freude über meine Firma kam erst sehr spät. Er war schon sehr, sehr alt, als er sagte, es sei schon wahnsinnig gut, dass ich mit Erfolg in einem Beruf arbeite, der vor den Gesetzen der Realität standhalten muss, während alle anderen in der Familie sich damit selten beschäftigten.
Wittstock: Warum haben Sie sich gegen die Architektur entschieden?
Peter Frisch: Ich war gerade mit dem Studium fertig, als mir mein Professor einen ersten Auftrag vermittelte: Der Bildhauer Bernhard Heiliger hatte ein Grundstück im Tessin gekauft, nicht weit von dem Haus meines Vaters in Berzona. Heiliger wollte dort ein Haus bauen, ich sollte es ihm entwerfen. Ich war ein naiver Student und stolz, dass ich, Peter Frisch, diesen Auftrag erhielt. Doch dann las ich in einer Zeitung: Bernhard Heiliger baut im Tessin ein Atelierhaus, und der Architekt ist der Sohn von Max Frisch. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Ich wollte da lesen: Der Architekt ist Peter Frisch. Da wurde mir klar, dass ich in jedem künstlerischen Beruf immer der Sohn meines Vaters bleiben würde.
Wittstock: Haben Sie sehr darunter gelitten?
Peter Frisch: Gelitten nicht. Ich habe ein dickes Fell gehabt. Aber genervt hat es schon. In der Schule hat der Deutschlehrer was Besonderes erwartet, wenn er Aufsätze von mir las, oder der Französischlehrer hat mich als Grammatikübung den Titel „Mein Name sei Gantenbein“ übersetzen lassen. Konnte er sich nicht was anderes einfallen lassen?
Wittstock: Haben Sie trotz allem ein Lieblingsbuch von Max Frisch?
Peter Frisch: Natürlich, aber das wechselt. Zurzeit ist mir „Stiller“ das liebste. Überhaupt, die Romane mag ich sehr, weil sie seine Sprechweise einfangen, weil ich ihn beim Lesen reden höre. Wenn man im Tessin zusammengesessen hat am Abend, dann kam es immer zu Gesprächen, die an die Themen seiner Romane erinnerten. Wobei die Gespräche immer von meinen Geschichten weggingen hin zu seinen Geschichten. Das war schon interessant: Ich versuchte, eine Geschichte zu erzählen, und er nahm sie auf, drehte sie um, und es war seine Geschichte. Großartig und sehr lehrreich, aber es war nicht mehr meine Geschichte.
Wittstock: So ist das oft bei Schriftstellern.
Peter Frisch: Er war eine dominante Ich-Person. Nicht nur mir gegenüber. Allen Freunden ging es so, wenn sie mit ihm zusammen waren.

Ursula Priess: "Sturz durch alle Spiegel. Eine Bestandsaufnahme". btb, 8,99 Euro
Wittstock: Ihre Schwester Ursula hat 2010 ein Buch über ihr Verhältnis zum Vater geschrieben. Werden Sie irgendwann einmal ein Buch über Max Frisch schreiben?
Peter Frisch: Nein, ganz sicher nicht. Das Schreiben ist nicht meine Stärke.
Wittstock: Ihre Schwester war verletzt wegen eines Satzes Ihres Vaters: “. . . die schlichte Nachricht, dass ein Kind gezeugt worden ist, hat mich gefreut: der Frau zuliebe . . .“ Was denken Sie über den Satz Ihres Vaters?
Peter Frisch: Das ist ein typischer Satz meines Vaters. Er lässt mich völlig unberührt. Das verletzt mich überhaupt nicht. Wir Kinder hatten oft Spaß mit ihm, aber er war nicht der Kinder-Papa. Ich kann das verstehen: Als ich jünger war, spielten Kinder für mich keine so große Rolle wie später. Mit 30 Jahren war ich noch viel mehr mit mir selbst beschäftigt, ich wollte etwas aus mir machen. Das Kind war ja gut versorgt bei der Mutter. Es war nett, ein Kind zu haben, aber es hatte nicht diese Wichtigkeit. Als ich 30 war, war es mir wichtiger, Deutscher Meister als Vater einer einjährigen Tochter zu sein. So war das bei ihm auch: Ihm war wichtig, wie kommt der nächste Roman an, wie die nächste Theaterpremiere – und, ach ja, Kinder habe ich auch noch.
Wittstock: Sind Sie Ihrem Vater ähnlich? Erkennen Sie an sich Züge, die Sie an ihn erinnern?
Peter Frisch: Ja. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Nur nicht das Schreiben. Aber zum Beispiel die Stimme: Am Telefon ist meine der seinen offenbar zum Verwechseln ähnlich. Dann meine Sehnsucht nach Großzügigkeit, nach offenen, freien Räumen. Er hat gern und sehr gut gekocht. Ich koche auch gern. Und hoffentlich gut.
Wittstock: Aber auch Ihre Direktheit und Klarheit erinnert an Ihren Vater. Zum Beispiel der Satz eben: Mit 30 sei es für Sie wichtiger gewesen, Deutscher Meister als Vater zu sein.
Peter Frisch: Ich glaube, es ist nicht egoistisch, wenn man mit 30 unbedingt Deutscher Meister sein will. Es ist nur ehrlich, wenn man das zugibt und ausspricht. Man darf darüber aber nicht rücksichtslos werden anderen gegenüber.
Wittstock: War Max Frisch nach der Scheidung von Ihrer Mutter oft für Sie da?
Peter Frisch: Wir waren regelmäßig an Wochenenden bei ihm. Und dann hat er sich sehr um uns gekümmert. Dann waren wir in den Bergen, und er hat Wasserräder am Bach mit uns gebaut oder Ähnliches. Einmal hat er eine kleine Modellbühne gebastelt, um sich Gedanken für das Bühnenbild seines nächsten Theaterstücks zu machen. Und ich habe ihm geholfen und kleine Stühle für die Bühne gemacht. Vielleicht habe ich auf diese Weise sogar mehr von meinem Vater gehabt als mancher andere. Denn wenn er in die Verantwortung genommen wurde, hat er sich sehr bemüht. Das war typisch für ihn: Wenn er etwas machte, dann machte er es richtig.
Wittstock: In jedem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern gibt es gelegentlich Streit. War das bei Ihnen und Ihrem Vater genauso?
Peter Frisch: Streit gab es eigentlich selten. Das lag sicher auch daran, dass wir uns nur jedes zweite Wochenende sahen. In dieser kurzen Zeit kann man Streit leichter vermeiden, als wenn man immerzu zusammenlebt. Zu Konflikten kam es, als er mir klarzumachen versuchte, ich müsse einen richtigen Beruf haben, nicht dieses bisschen Segeln da. Das war die Zeit, in der wir uns wenig gesehen haben. Ich habe ihn wohl zwei Jahre lang nicht besucht, er hat sowieso nie angerufen – bis er dann mal einen Brief geschrieben hat.
Wittstock: Ist Ihr Vater ein Vorbild für Sie?
Peter Frisch: In vielen Punkten ist er ein Vorbild. Ich will etwas ganz Banales sagen: sein Auftreten zum Beispiel. Er wusste, wie man, ohne zu protzen, großzügig ist. Er konnte sehr gut umgehen mit Menschen, er hatte Charme. Er war ein Grandseigneur.
Wittstock: Ihr Vater war ein Mann der Frauen. Er hatte viele Partnerinnen, viele Geliebte. Hat das Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater beeinflusst?
Peter Frisch: Eher positiv. Natürlich war es schmerzhaft, dass er nicht mehr mit meiner Mutter zusammen war, aber daran hat man sich irgendwann gewöhnt. Und mit den späteren Partnerinnen meines Vaters bin ich durchweg gut zurechtgekommen. Vor allem mit Marianne, seiner zweiten Ehefrau, habe ich mich sehr gut verstanden, sie war nicht viel älter als ich. Das war eine tolle Frau. Auch als ich mich eine Zeit lang nur schlecht mit meinem Vater verstand, hat eine seiner Frauen dafür gesorgt, dass der Kontakt zwischen uns beiden wieder aufgenommen wurde.
Wittstock: Sie haben mal gesagt, die Liebe zur Schönheit hätten Sie von Ihrem Vater geerbt. Ist diese Liebe Genuss oder Last für Sie?
Peter Frisch: Last? Warum sollte das eine Last sein? Schöne Dinge anzuschauen ist doch ein Genuss
Wittstock: Aber es gibt so wenig davon.
Peter Frisch: Nein, das finde ich nicht. Das ist doch eine Frage des Blickwinkels: Schaue ich aus dem Fenster und suche nach den hässlichen Sachen, werde ich eine Menge finden. Schaue ich hinaus und konzentriere mich auf die schönen Dinge, die es auch gibt, habe ich die Möglichkeit, sie zu genießen. Zum Genussmenschen gehört halt, dass er sich die Dinge sucht, die er genießen kann.