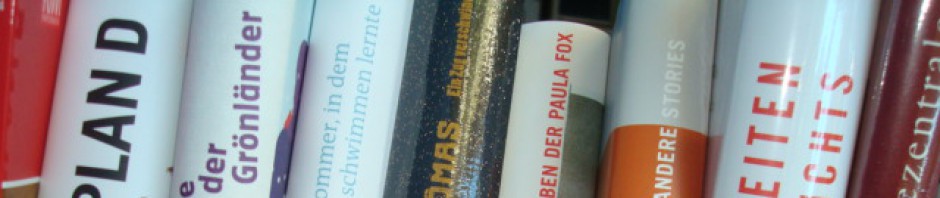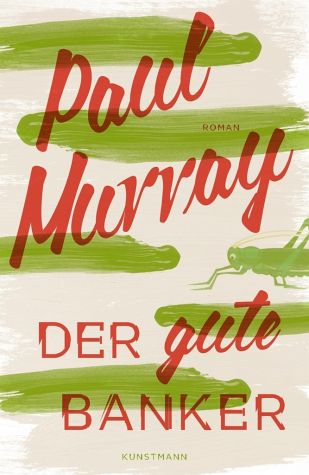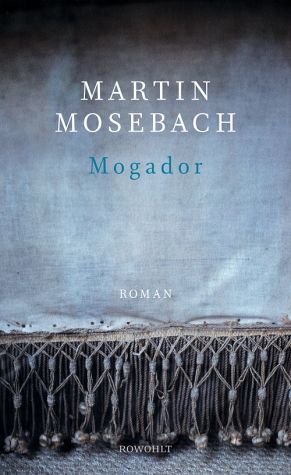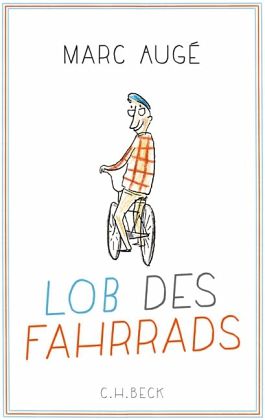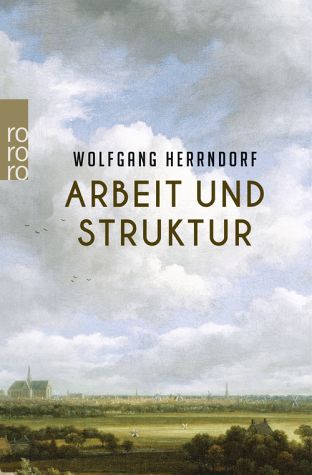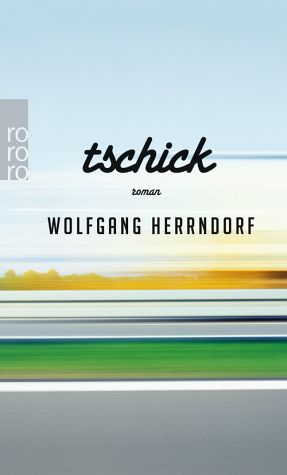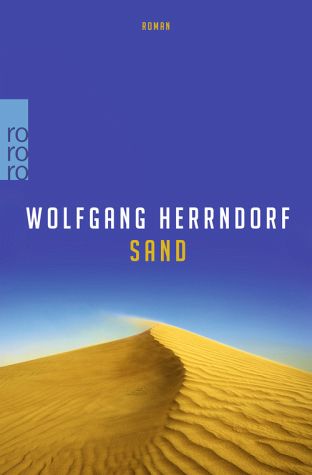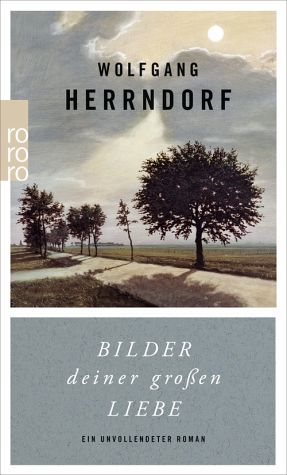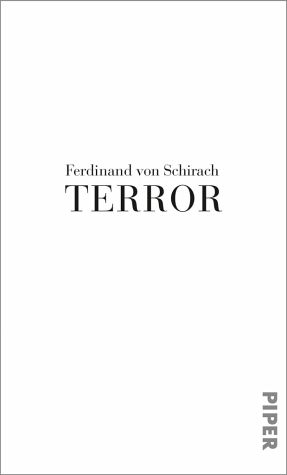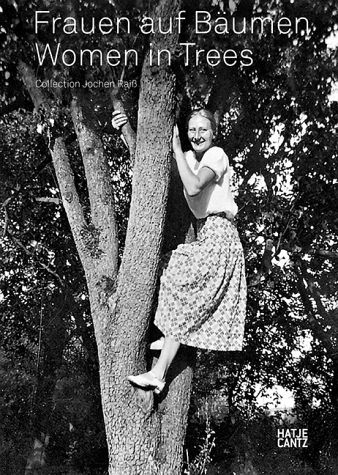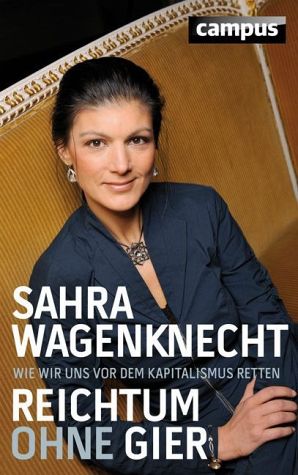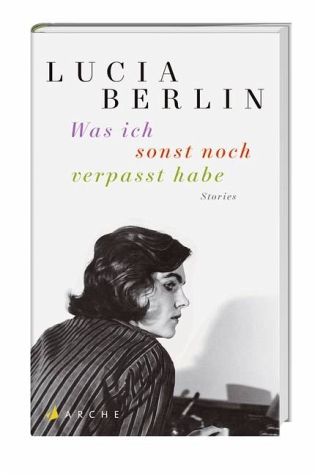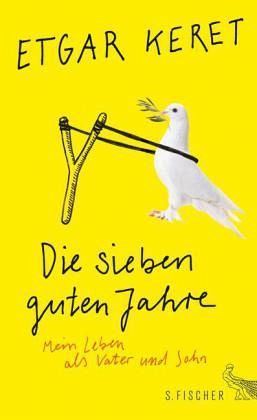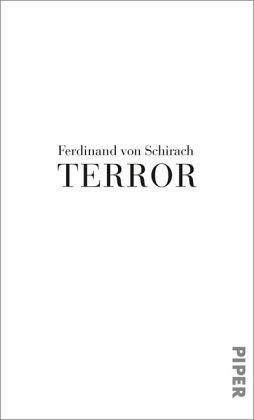Die böse, bissige, burleske Euro-Komödie
Die europäische Finanzkrise hat Stoff für Tausende von Tragödien geliefert. Der irische Schriftsteller Paul Murray hat sie einen ebenso klugen wie komischen Roman verwandelt: “Der gute Banker”. Ich traf Murray in Dublin in einem der berühmtesten Pubs der Stadt und sprach mit ihm über seinen Roman.
Sie haben Irland verkauft“, sagt Paul Murray, „das ganze Land. Gleich zweimal.“ Wir stehen im „Mulligan’s“, einem der berühmten Pubs von Dublin. Aber Murray ist stocknüchtern, er hat weder Guinness noch Whiskey getrunken, nur Kaffee. Er schreit, flucht oder schimpft nicht, sondern redet ruhig und sachlich, und vieles spricht dafür, dass Murray Recht hat: „Sie haben Irland verkauft.“
„Mulligan’s“ liegt nicht in Dublins Touristenviertel Temple Bar, sondern in einer schäbigen, DDRgrauen Nebenstraße, die tatsächlich so aussieht, als wäre das Land zum Dumpingpreis zu haben. „Mulligan’s“ ist älter als die Französische Revolution. Generationen irischer Schriftsteller und Journalisten haben hier getrunken, geraucht und schwadroniert. Die Redaktionen lagen gleich um die Ecke. James Joyce soll hier Notizen für „Ulysses“ gemacht haben, Nobelpreisträger Seamus Heaney für seine Gedichte.
Doch die Geschichte, die Murray in seinem Roman „Der gute Banker“ erzählt, klingt noch fantastischer, noch extremer als die seiner Vorgänger. Dabei hat Murray sie nicht frei herbeifabuliert, sondern nach dem realen Vorbild der Bankenkrise in Irland entworfen, deren Ausmaß in Europa einmalig ist: „Es gab allerdings ein Problem. Manche Leute, die damals am Ruder waren, benahmen sich so bizarr, so übel, dass sie selbst als Romanfiguren unglaubwürdig wirken. Ich musste sie harmloser schildern, als sie wirklich waren, damit die Leser sie mir abnehmen.“
Aber das Buch ist nicht nur in vielen seiner Eckdaten wahr, es ist zugleich auch voller Witz. Murray hat das erstaunliche Kunststück vollbracht, aus der Krise eine Komödie zu machen.
Sein Held ist Claude, ein schüchterner Franzose, der in Dublin für eine fiktive Investmentbank arbeitet. Er lernt den irischen Schriftsteller Paul kennen, der sich bei ihm einschmeichelt und vorgibt, über ihn als Jedermann der globalisierten Finanzwelt einen Roman schreiben zu wollen. Bald stellt sich aber heraus, dass Paul als Autor längst gescheitert ist und in Wahrheit den Safe von Claudes Bank ausräumen will. Bis Claude ihm klarmacht, dass es in einer Investmentbank gar keinen Safe gibt.
Woraufhin Paul sich nach anderen Erwerbsquellen umschaut, vom Geschäft mit hanebüchenen Websites bis zum Kunstraub – und Claude jedes Mal in seine Wahnsinnsprojekte verstrickt. Bis es Claude endlich gelingt, ihn wieder an den Schreibtisch zurückzubugsieren, eine neue Romanidee vor Augen.
Parallel zu diesen kleinkriminellen Abenteuern erlebt Claude einen großkriminellen Banken-Thriller von historischem Ausmaß. Im Spätsommer 2008 geriet die Anglo Irish Bank – in Murrays Roman heißt sie Royal Irish – ins Trudeln, nachdem sie jahrelang völlig verantwortungslos Immobilienkredite unters Volk gebracht hatte.
Manager der Bank spiegelten der irischen Regierung durch haarsträubende Manipulationen vor, ihr Haus sei systemrelevant und mit einer Finanzspritze von sieben Milliarden Euro zu retten. Am Ende kostete es die irischen Steuerzahler jedoch über 30 Milliarden, rund ein Siebtel des gesamten Bruttoinlandsprodukts, was das kleine Land fast im Alleingang in den Ruin trieb.
Trotzdem wurden die Verantwortlichen Jahre später nur zu lächerlich geringen Haft- oder Bewährungsstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren verurteilt, wenn nicht gar freigesprochen. Denn die Richter stellten fest, die Kontrollen der irischen Bankenaufsicht seien in jenen Jahren so miserabel und unfähig gewesen, dass es nicht möglich sei, den Managern die Schuld für die Bankenpleite allein zuzurechnen.
„Sie müssen das verstehen“, sagt Murray, „Irland war immer arm: wenig Bodenschätze, keine Industrie, schlechtes Farmland. Als der Bankenboom in den 90er-Jahren begann, sah Irland seine Chance gekommen und wollte einen Teil vom Kuchen abhaben.“ Das Land liberalisierte das Finanzgeschäft radikal, bis es nahezu keine Kontrollen mehr gab. Heute gilt Irland als Offshore-Steuerparadies, in dem sich aus guten Gründen die Hälfte der 50 Top-Banken und die Hälfte der 20 Top-Versicherungen der Welt niedergelassen haben.
„Damit wurde“, so Murray, „das Land symbolisch zum ersten Mal verkauft. An die Hedgefonds, an die Investmentbanken, die hier tun können, was sie wollen. Und sie tun es, glauben Sie mir.“ Im Jahr 2015 zum Beispiel explodierte das Bruttoinlandsprodukt Irlands plötzlich um astronomische 26,3 Prozent. Deutschland verzeichnete im gleichen Jahr 1,7 Prozent. Wegen der niedrigen Unternehmenssteuer verlegen multinationale Unternehmen ihren Sitz rechtlich nach Irland, „auch wenn sie nur ein Firmenschild an die Tür eines leeren Büros kleben“.
Für die Iren springt dabei nahezu nichts heraus. „Im Gegenteil, sie werden oft noch ärmer“, sagt Murray. „Jetzt wird das Land zum zweiten Mal verkauft, und diesmal buchstäblich. Hausbesitzer, die ihre Kreditenicht bezahlen können, fliegen raus, und ihre Grundstücke gehen an ausländische Investoren.“
Das ist der Stoff für Tausende von Tragödien. Doch nach bewährter irischer Tradition hat Paul Murray ihn in eine böse, bissige, burleske Komödie verwandelt. Ein Buch voller überraschender Wendungen, Spott und lebenskluger Ironie. Die Iren waren, sagt er, über Jahrhunderte ein kolonisiertes Volk, erst 1922 konnten sie ihre Freiheit von den Briten erkämpfen. Vielleicht sind die Banken Irlands neue Kolonialherren. Und die in Grund und Boden zu lachen gehört zu den ältesten irischen Überlebensstrategien.