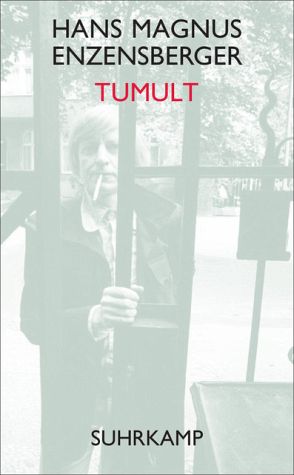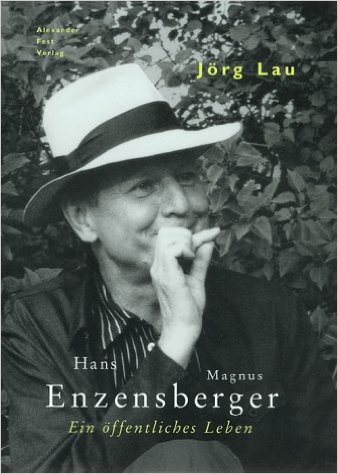Liebe in den Zeiten der Rebellion
Nie wollte Hans Magnus Enzensberger seine Autobiographie schreiben. Nun hat er es doch getan – zumindest für ein kurzes, aber wichtiges Kapitel seines Lebens: In „Tumult“ erzählt vom wilden Jahr 1968 und seiner großen, verwirrenden Amour fou – lässt dabei aber Wichtiges ungesagt. Jetzt ist der Band als Taschenbuch erschienen. Eine Leseempfehlung.
Hans Magnus Enzensberger ist der Lucky Luke der deutschen Literatur: schlank, lässig, ungebunden. Und: schnell. Der schnellste Dichter-Denker im Westen. Als die Nachkriegsautoren 1960 noch mühsam durchbuchstabierten, was denn die von den Nazis verbotene literarische Moderne sei, erfand er schon im Vorübergehen die Postmoderne.
Doch sich an irgendeiner Theorie fest- oder aufzuhalten, war seine Sache nicht. Lieber blieb er im Sattel, immer auf dem Weg zu neuen und allerneuesten Horizonten. Er ist, in geistiger wie in geografischer Hinsicht, einer der meistgereisten Schriftsteller des Landes. Ein Reiter mit leichtem Gepäck, souverän, ironisch, frei, der nichts so verabscheut wie Versuche, ihn an die Kette zu legen.
Doch in seiner geistigen Abenteurer-Biografie gibt es ein paar Jahre der Peinlichkeit. Es ist die Zeit der Studentenbewegung zwischen 1966 und 1970, in der er weniger der intellektuellen Pflicht zum Zweifel huldigte als vielmehr der Freude an der linken Parole. Später ließ er sich nur ungern zu dieser Phase seines Lebens befragen und gab sich wortkarg wie ein verwitterter Cowboy.
Doch kurz vor seinem 85. Geburtstag schlug Enzensberger wieder mal einen jener überraschenden Haken, für die er legendär ist. Von ihm sei, so ließ er schon mehrfach wissen, eine Autobiografie nicht zu erwarten, da er derlei Schriften allesamt für halb bewusste, halb unbewusste Fälschungen halte: „Man braucht weder ein Kriminologe noch ein Erkenntnistheoretiker zu sein, um zu wissen, dass auf Zeugenaussagen in eigener Sache kein Verlass ist.“
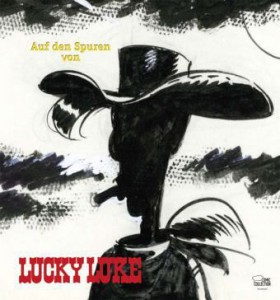
Morris: "Auf den Spuren von Lucky Luke". Übersetzung: Horst Berner. Verlag: Ehapa Comic Collection. 70 Euro
Doch dann fand Enzensberger, so schreibt er es zumindest, in seinem Keller, „zwischen Weinregal und Werkzeugkasten“, eine verstaubte Pappschachtel mit lange vergessenen Briefen, Notizen und Fotos, ausgerechnet aus den politisch so brisanten 60er-Jahren. Da Inkonsequenz eine seiner lange geübten Stärken ist, hat er aus diesem autobiografischen Material jetzt – nicht ohne zuvor einiges auszuklammern und anderes zu bearbeiten – ein Buch gemacht, es auf den Titel „Tumult“ getauft und sich selbst zum Geburtstag geschenkt.
Tumult meint nicht nur das politische Getümmel jener Zeit, sondern vor allem einen persönlichen Liebestumult Enzensbergers. Auf einem „Friedenskongress“ in Baku am Kaspischen Meer entflammte er 1966 für eine Russin namens Maria, genannt Mascha – und zwar so sehr, dass er in seinen damaligen Aufzeichnungen nicht mal die Farbe ihrer Augen ohne Verwirrung notieren konnte: Erst sind sie „grün schimmernd“ und nur zwei Seiten später von einem „strahlenden Blau, das bald in ein metallisches Grau, bald in ein Türkis changieren kann“.
Die beiden Verliebten lassen sich von ihren jeweiligen Ehepartnern scheiden und heiraten ein knappes Jahr später in Moskau. Doch mit Maschas Ausreise aus der Sowjetunion beginnt der qualvolle Teil dieser Amour fou: Mascha erweist sich, so zumindest beschreibt es Enzensberger, als psychisch gefährdet, rasend eifersüchtig und für ein Alltagsleben untauglich. Da Deutschland sie maßlos enttäuscht, siedelt sie gleich weiter um nach London. Und Enzensberger lässt sich wie auf der Flucht um den Globus treiben.
Es beginnt eine rastlose Suche nach einem Ort, der das Zusammenleben möglich macht. Nach vier Monaten in den USA („Mascha war nicht glücklich“) wirft Enzensberger einer amerikanischen Universität ein üppig dotiertes Stipendium vor die Füße – und begründet seine Abreise ideologisch: Das Ziel der US-Regierung sei „die politische, ökonomische und militärische Weltherrschaft“. Dann verbringt das Paar ein knappes Jahr in Fidel Castros Cuba („Mascha war glücklich“), angeblich, um die Revolution zu unterstützen. Doch schließlich erkennt Enzensberger die diktatorischen Züge des Regimes und verabschiedet sich Richtung Berlin.
Eine anrührende Liebesgeschichte. Enzensberger hat sein Privatleben bislang gegen die Öffentlichkeit weitgehend abgeschirmt. Wenn er diese Deckung jetzt teilweise aufhebt, darf er sich neugieriger Blicke sicher sein.
Doch aus politischer Sicht ist das Buch enttäuschend. Den größten Teil nimmt ein Selbstgespräch ein, in dem der alte Enzensberger fiktiv den jungen Enzensberger der 60er-Jahre nach seinen Motiven ausfragt. Doch er fragt so zahm und lahm, dass er sein junges Ich nie in Verlegenheit bringt.
Enzensbergers vorübergehende ideologische Radikalisierung fällt recht genau in die Zeit seiner Liebesschlachten mit Mascha. Kann es sein, dass seine erotische Konfusion eine Konfusion in seinem politischen Denken nach sich zog? 1971 trennte er sich von seiner Frau und kehrte danach auch in seinen Essays zu vertrauten, von Ironie und Zweifel geprägten Tonlagen zurück.
Das alles hat mehr als nur literaturgeschichtliche Bedeutung. Enzensberger nahm mit seiner Zeitschrift „Kursbuch“ erheblichen Einfluss auf die Studentenbewegung, er nennt sie heute noch stolz ein „Leitmedium“ jener Jahre. Sicher, er hat nie der Gewalt das Wort geredet. Aber wenn Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Andreas Baader im Mai 1970, unmittelbar nachdem sie den Häftling Baader aus Polizeigewahrsam befreit hatten, zu Enzensbergers Haus nach Berlin-Friedenau flohen, zeigt das, welche wichtige Rolle er seinerzeit für manche Wirrköpfe spielte.
Enzensberger hätte also Gründe, seine damalige Rolle einmal selbstkritisch zu beleuchten. Doch mit der charmanten Geste des literarischen Dandys winkt er ab: Ihm sei „weder an einem Verhör noch an einer Beichte gelegen“. Dem Dichter Enzensberger wird das niemand vorwerfen wollen. Doch von dem politischen Publizisten Enzensberger würde man das alles gern etwas genauer erklärt bekommen.