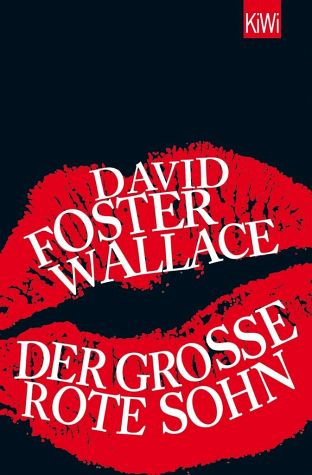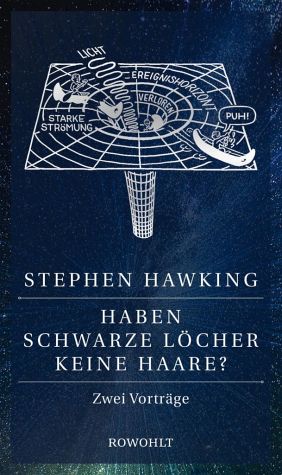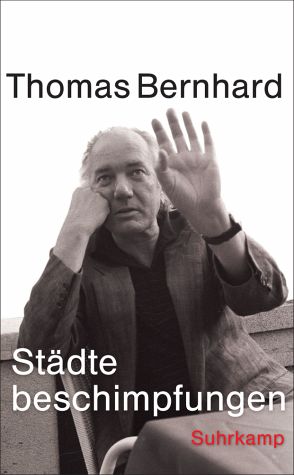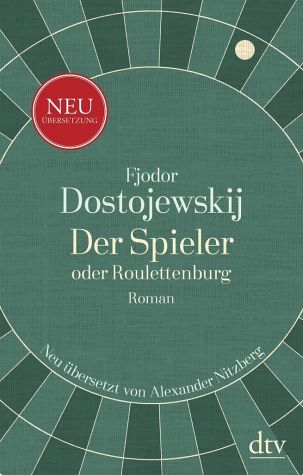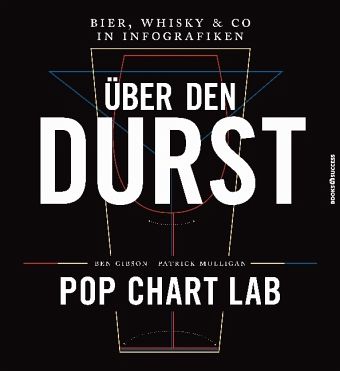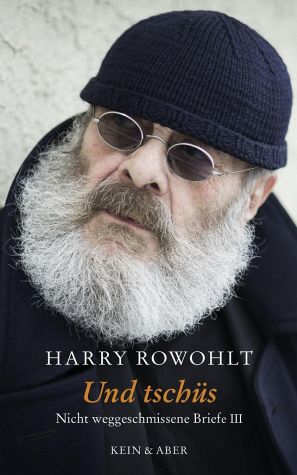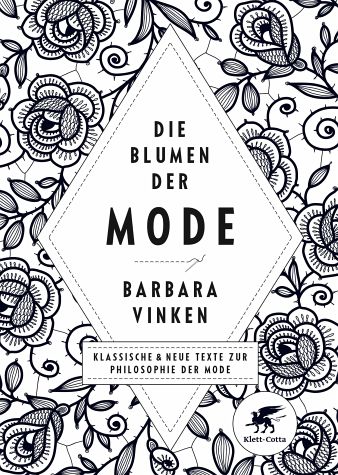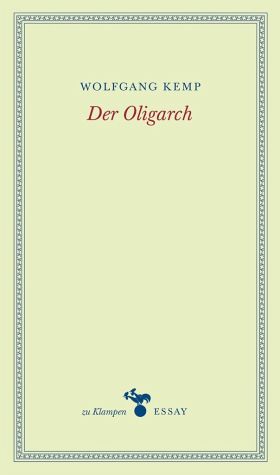Wer könnte ich sein?
Oder: Lobrede auf Benedict Wells
Was lernt man in Lebenskatastrophen über sich selbst? In seinem Roman “Vom Ende der Einsamkeit” erzählt Benedict Wells von drei Kindern, die ihre Eltern verlieren. Und sich fragen, wer sie geworden wären, hätten sie länger in einer Familie statt einem Internat aufwachsen dürfen. Das Buch stand lange auf allen Bestsellerlisten und ist einer der erfolgreichsten deutschen Romane des Jahres 2016. Am 28. November wurde Wells in Berlin für “Vom Ende der Einsamkeit” mit dem mit 12.000 Euro dotierten Buchpreis für Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. Ich durfte den Lobgesang auf das Buch anstimmen. Hier ist er:
Sehr geehrte Frau Hess-Maier, lieber Benedict Wells, meine Damen und Herren,
allen Menschen, so schrieb der Philosoph Ernst Bloch einmal, erscheine in ihrer Kindheit etwas, „worin noch niemand war: Heimat“. Der Satz gehört zu den meistzitierten Sätzen aus Blochs Werk. Es gab Jahre, in denen sich viele freundlichen Seelen, aber auch Seminaristen der Weltrevolution so häufig auf diesen Satz beriefen, dass er bald fadenscheinig wirkte. Bloch hat in den Jahren der Weimarer Republik lange fürs Feuilleton gearbeitet, er verstand sich viel besser auf mitreißende Formulierungen, als man das bei einem deutschen Philosophen erwarten würde. Ob dieser bezaubernde Satz nur fauler Zauber der Rhetorik ist, oder eine zauberhafte, tiefe Wahrheit formuliert, kann letztlich wohl jeder nur für sich selbst und für seine Erfahrungswelt klären.

Benedict Wells: "Vom Ende der Einsamkeit". Roman. Diogenes Verlag. 22 Euro
Mir ging Blochs Satz im Kopf um, als ich den Beginn von Benedict Wells’ Roman „Das Ende der Einsamkeit“ las. In diesen Anfangskapiteln stellt uns der Autor die Familie Moreau vor: die Eltern, die bald beim Autounfall ums Leben kommen werden, den verträumten Jules, aus dessen Perspektive und von dessen Leben der Roman vor allem erzählt, seine impulsive Schwester Liz, den eigenwilligen, zugeknöpften Bruder Marty, und auch die kühle, fern und bitter wirkenden Großmutter. Es wäre leicht gewesen – und jeder schwache Schriftsteller hätte sich vielleicht dazu verführen lassen – das frühe Zusammenleben dieser Familie harmonischer zu schildern, als Benedict Wells es tut. Im Grunde erfahren wir Leser nur von den feinen Bruchlinien, die sich zwischen den Beteiligten abzeichnen, von den Zänkereien zwischen den Kindern, von der zuerst großen Zuneigung, dann der zunehmenden Entfremdung zwischen den Eltern, von der Schwäche des Vaters und dem distanzierten Verhältnis zur Großmutter.
Nein, als ungetrübte Idylle werden die Jahre der Familie Moreau, in denen die Eltern noch am Leben sind, keineswegs geschildert. Haben die drei Kinder Jules, Marty und Liz also je die Chance gehabt, ihre Kindheit in jener Sphäre zu verbringen, die Bloch mit dem großen, ja fast erdrückend großen Wort Heimat benennt?
Gleich in diesem Eröffnungskapitel, in der Exposition des Romans zeigt sich das literarische Talent des Schriftstellers Wells. Denn obwohl er fast nur von Familienproblemen erzählt, von kleinen, von schleichenden, von verschwiegenen Konflikten, gelingt es ihm dennoch, dem Leser spürbar zu machen, dass und wie sehr die drei Kinder in dieser Familie zu Hause sind, dass also diese Familie mitsamt ihrer Konflikte das Fundament ist, auf dem die Kinder stehen und aufwachsen. Es ist, glaube ich, nicht zuletzt der Ton der Vertrautheit, mit der Jules von diesen spannungsvollen Kräftefeldern innerhalb der Familie berichtet, durch den Wells dieses Kunststück gelingt. Wenn Heimat als ein Ort verstanden wird, in dessen Schönheiten, aber auch in dessen Widersprüchlichkeiten und Kontoversen man wie selbstverständlich hineingewachsen und hineinverwoben ist, dann haben die Kinder Moreau diese Kindheitsheimat wohl tatsächlich erlebt. Wenn man, wie Bloch unter Heimat einen Ort jenseits jeder Entäußerung und Entfremdung versteht, dann hat das letztlich wohl mehr mit universaler Eschatologie als mit konkreter Utopie zu tun.
Wie gut sich Benedict Wells mit Kindheit auskennt und wie genau er sie zu beschreiben versteht, erkennt man noch an einem anderen Aspekt dieses Romanbeginns. Die drei Geschwister Moreau fühlen sich in ihrer Familie sicher und daheim. Aber sie kennen sie nicht. Zumindest nicht deren Vergangenheit. Warum der Vater Frankreich verließ, weshalb er sich mit seiner deutschen Frau ausgerechnet in München niederließen, wieso sein Verhältnis zu seiner Mutter gestört und was eigentlich mit dem früh verstorbenen Onkel Eric geschehen ist, für all das hat Jules allenfalls pauschale Allerweltsantworten. Solche Fragen interessieren ihn nicht. Seine Familie gibt ihm, was er braucht: Geborgenheit. Also ist sie für ihn gut. Alles andere kann ihm gestohlen bleiben. Wir wachsen in unseren Familien nicht auf als Biografen oder Historiker unserer Eltern oder sonstigen Vorfahren. Uns interessiert nicht die Herkunft, sondern die Gegenwart. Das Fragen nach Gründen und manchmal auch nach den Abgründen der Familiengeschichten kommt erst Jahre später und dann müssen wir meist tief graben, bis unter den Allerweltsantworten die etwas spezielleren Wahrheiten sichtbar werden.

Benedict Wells: "Vom Ende der Einsamkeit". Roman. 6 Audio-CDs. 455 Minuten. gesprochen von Robert Stadlober. Diogenes Verlag. 25 Euro
Die Kindheit der Geschwister Moreau endet abrupt mit einem Anruf kurz nach Weihnachten, als sie 11, 13 und 14 Jahre alt sind. Der Tod der Eltern verändert nicht nur ihre Lebenswege, sondern er verändert sie selbst, er verändert sie in ihrem Wesen. Das ist die Versuchsanordnung des Romans: Benedict Wells spürt dem Unterschied nach zwischen den Personen, die diese drei Kinder möglicherweise hätten werden können und den Personen, die sie nach ihrer Lebenskatastrophe tatsächlich geworden sind. Zumindest denkt Jules häufig über diese Fragen nach, nicht zuletzt weil er mit seiner Entwicklung hadert, die ihn mutloser und gehemmter hat werden lassen. Doch Wells bieten uns mit Liz und Marty noch zwei andere Reaktionsweisen auf die selbe gewaltsame Lebenszäsur an: Liz erweist sich als der Gegensatz zum introvertierten Jules, sie ist lebenshungrig, ungestüm und reichlich unachtsam im Umgang mit ihrer Gesundheit. Die Diagnose dazu stellt sie sich selbst: Sie habe nach dem Tod der Eltern „dafür gesorgt, dass es nie mehr still war, dass mein Geist nie mehr zur Ruhe kam.“ Denn so ein Dasein im Modus permanenter Höchstgeschwindigkeit ist keine schlechte Möglichkeit, unerwünschte Empfindungen unempfunden hinter sich zurückzulassen. Und Marty? Marty war immer schon, wie man früher gesagt hätte, ein Tüftler. Heute gibt man diesem Menschenschlag gern den Namen Nerd. Er ist eher an Aufgaben, an komplexen Problemen, an Sachfragen interessiert, sein Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen ist geringer und reduziert sich auf ganz wenige Personen, weshalb es leicht so wirkt, wie Jules einmal sagt, als fühle Marty sich „im Innersten unangreifbar“.
Wer sich ganz eng an dem Begriff „Familienroman“ festklammert, kann sich auf den Standpunkt stellen, im Grunde erzählten nur die ersten 50 Seiten dieses Buches bis zum Unfalltod der Eltern tatsächlich von einer kompletten Familie. Doch ich glaube, auf diese Weise wird man der Idee nicht gerecht, die wohl hinter einem Familienroman stehen sollte, nämlich mit literarischen Mitteln, mehr über dieses ebenso einmalige wie vielfältige Beziehungsgeflecht Familie zu erfahren. Benedict Wells’ Roman „Vom Ende der Einsamkeit“ ist vieles zugleich, ein Kindheitsroman, ein Liebesroman, ein psychologischer Entwicklungsroman. Aber neben all dem ist er vor allem eines: ein Familiensehnsuchtsroman. Jedes der drei Geschwister Moreau versucht auf seine Weise jenes Beziehungsgeflecht, aus dem sie so früh herausgerissen wurden, für sich wiederherzustellen: Der in sich und seinen wissenschaftlichen Interessen ruhende Marty, indem er sich sehr früh für eine Frau entscheidet, und dann erleben muss, dass seine Ehe kinderlos bleibt. Liz, deren heikle Leidenschaft für starke Männer sie von einer Liebelei in die nächste treibt, es ihr aber zugleich schwer macht, zu einer dauerhaften Bindung zu finden. Und Jules, der verträumte Zögerer, der viele Jahre und endlose Umwege braucht, bis er seine große Liebe Alva erobert hat und sie dann viel zu schnell wieder an den Krebs verliert.
Vielleicht ist diese Familiensehnsucht eine der Unabänderlichkeiten in den Charakteren der Moreau-Kinder, die auch vom Tod der Eltern unberührt bleibt, ja eher sogar noch verstärkt wird. Ansonsten ist Benedict Wells viel zu behutsam, als dass er bündige Antworten auf die Fragen geben würde, die aus der Versuchsanordnung seines Romans folgen. Vielmehr lässt er die Figuren verschiedene Möglichkeiten durchspielen, was aus ihnen hätte werden können, wenn sie länger mit den Eltern und nicht im Internat aufgewachsen wären. Von der philosophisch geschulten Alva zum Beispiel werden Überlegungen Kierkegaards zur Persönlichkeitsbildung erwogen, die in dem recht martialisch klingenden Satz kulminieren: „Das Selbst muss gebrochen werden, um Selbst zu werden.“ Also die Überzeugung, dass sich der wahre Charakter einer Person erst dann enthüllt, wenn sie durch massive und schmerzhafte Lebensprüfungen auf die Probe gestellt wurde. Jules formuliert das gegen Ende des Romans ähnlich, aber viel vorsichtiger: „Als junger Mann hatte ich“, sagt er, „das Gefühl, seit dem Tod meiner Eltern ein anderes, falsches Leben zu führen. Noch stärker als meine Geschwister habe ich mich gefragt, wie sehr mich Ereignisse aus meiner Kindheit und Jugend bestimmt haben, und erst spät habe ich verstanden, dass in Wahrheit nur ich selbst der Architekt meiner Existenz bin. Ich bin es, wenn ich zulasse, dass meine Vergangenheit mich beeinflusst, und ich bin es umgekehrt genauso, wenn ich mich ihr widersetze.“
Womit sich dann allerdings abschließend die Frage stellen ließe, durch was dieses Ich denn geformt wird, dass sich durch Schicksalsschläge entweder beeinflussen lässt oder sich ihnen widersetzt, dass durch sie stark und unbeirrbar wird wie Marty oder selbstzweiflerisch bzw. sprunghaft wie Jules und Liz? Und der Seelenkenner Sigmund Freud würde an dieser Stelle vielleicht noch auf die grundlegende Ambivalenz jener Anlagen hinweisen, die sich über kurz oder lang zu einem Charakter ausformen, dass also kein Charakter von Anfang an beeinflussbar oder widerständig, stark oder schwach, gut oder böse ist, sondern eben beides zugleich und es kaum möglich ist, die Gründe namhaft zu machen, die eine der beiden Seiten vorübergehend oder dauerhaft die Oberhand gewinnen lassen.
Der Roman von Benedict Wells versucht nicht dieses Rätsel zu lösen. Das wäre größenwahnsinnig und sehr wahrscheinlich schlechte Literatur. Wells erzählt vielmehr von diesem Rätsel, er zeigt uns Menschen, die von diesem Rätsel umgetrieben werden und stellt es damit seinen Lesern in all seiner Unergründlichkeit vor Augen. Das ist ihm in seinem Roman auf beeindruckende, auf großartige Weise gelungen. Deshalb möchte ich ihm hiermit gleich zweifach gratulieren. Erstens natürlich, wie es sich für den Laudator gehört, zum Buchpreis 2016 der Stiftung Ravensburger Verlag, zweitens aber zu seinem lebensklugen Roman. Herzlichen Glückwunsch.