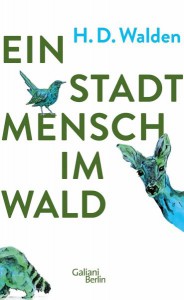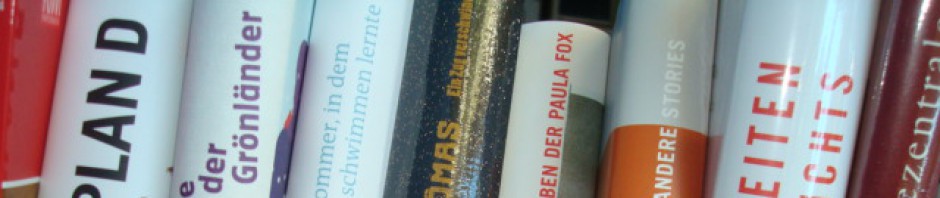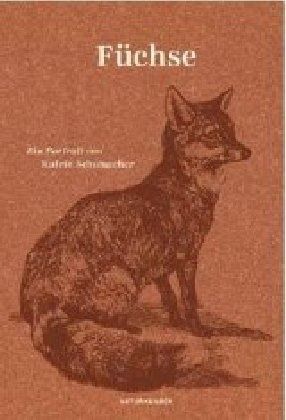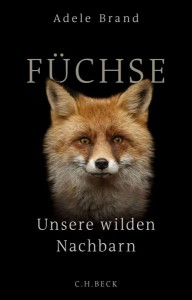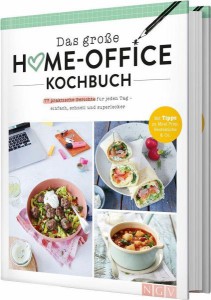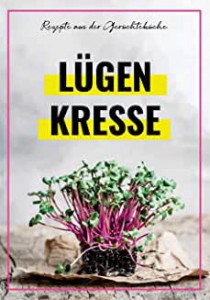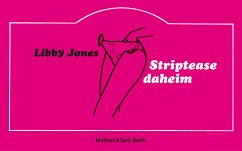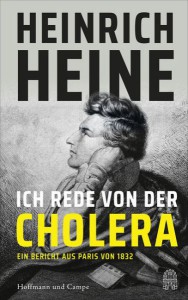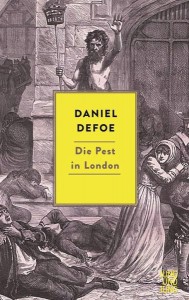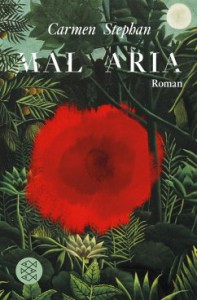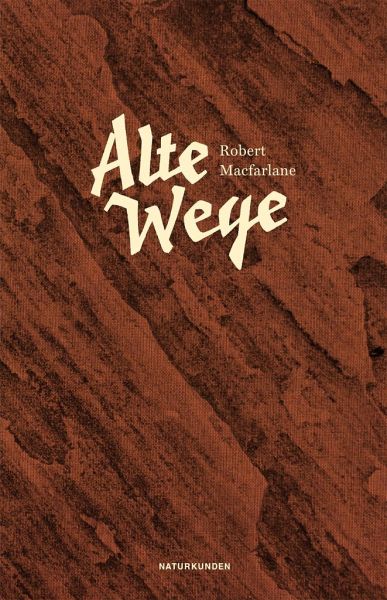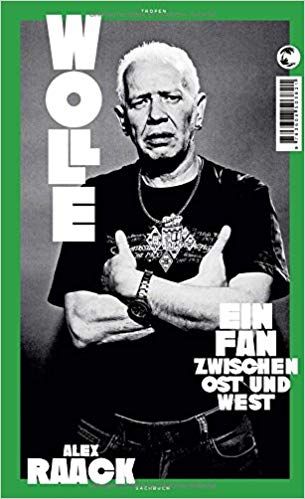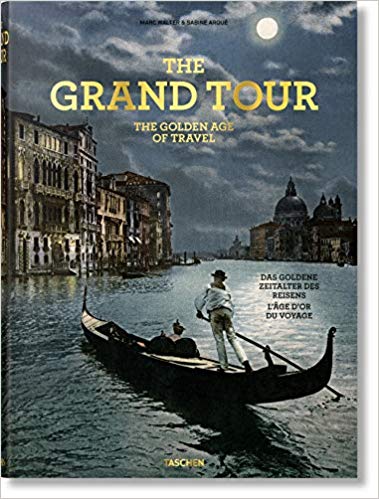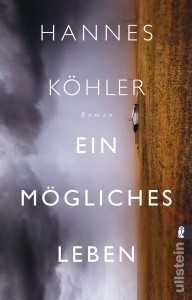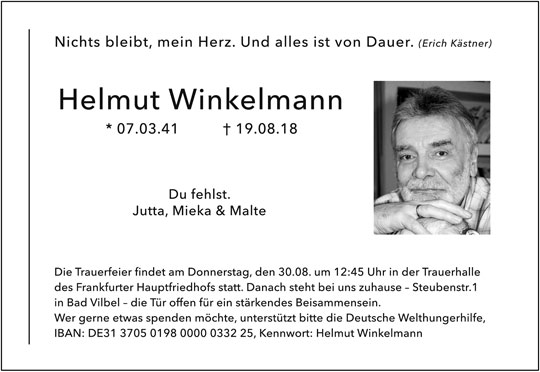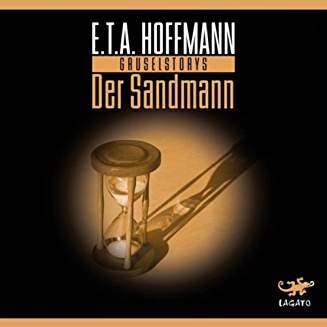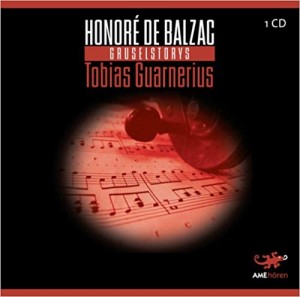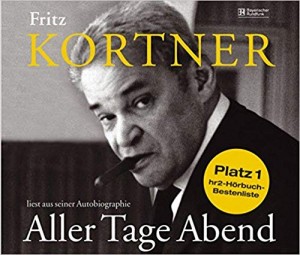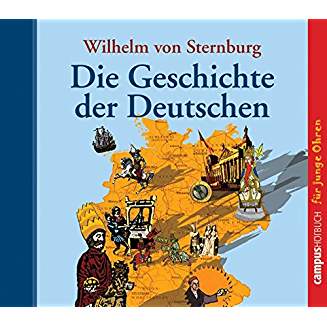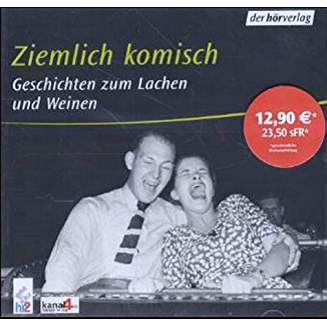Der lange Kampf gegen die Vergangenheit
Am 26. November wurde der Schriftsteller Hannes Köhler für seinen Roman “Ein mögliches Leben” (Ullstein Verlag) mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger 2018 ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises fand in Berlin statt, ich durfte dazu eine Laudatio auf den Roman beisteuern – und saß danach mit Hannes Köhler und seiner spanischen Freundin einen Abend lang bei einem sehr guten, von der Stiftung organisierten Essen beisammen. Meine kleine Lobrede möchte ich hiermit gern zur Diskussion stellen.
Sehr geehrte Frau Hess-Meyer,
sehr geehrter Herr Hauenstein,
vor allem aber: sehr geehrter Hannes Köhler
und sehr verehrte Damen und Herren,
es gibt einen Satz von William Faulkner, der hierzulande immer wieder gern zitiert wird. Er lautet: „Die Vergangenheit ist niemals tot, sie ist noch nicht einmal vergangen.“ Er stammt aus Faulkners „Requiem für eine Nonne“ und nicht aus seinem wohl berühmtesten Buch „Licht im August“, auf das Hannes Köhler in seinem Roman gelegentlich anspielt. Der Held aus „Licht im August“ heißt Joe Chrismas und winkt uns Lesern freundlich zu von einem der amerikanischen Kartoffelfelder, von denen Köhler in seinem Roman erzählt.

Hannes Köhler, Foto Copyright Gerald von Foris
Es ist ein Satz, der es in sich hat. Man kann ihn wie ein Motto sowohl über viele Gesellschaftsromane als auch Familienromane setzen. Und das ist kein Zufall, denn kluge Familienromane erzählen aus einer gleichsam mikroskopischen Perspektive von der Geschichte der Gesellschaft, deren kleinste soziale Einheiten eben die Familien sind. Hannes Köhlers Roman ist ein solcher kluger, klug gebauter Familienroman, der sich die Zeit nimmt, am Beispiel des Schicksals eines Mannes namens Franz Schneider zu zeigen, dass die Vergangenheit niemals tot, ja dass sie noch nicht einmal vergangen ist, sondern dass sie mit umso größerer Macht fortwirkt, je mehr wir uns der Illusion hingeben, sie sei längst abgetan und vergessen.
Das Besondere und das in meinen Augen literarisch besonders Gelungene an Köhlers Roman ist dabei, dass er nicht der Versuchung erliegt, aus seiner Hauptfigur Franz Schneider einem Helden nach dem Geschmack unserer Gegenwart zu machen. Er zeigt ihn stattdessen als Spielball und Opfer der deutschen Geschichte in der entsetzlichen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, er zeigt ihn als einen Mann, der im Tumult mörderischer politischer Katastrophen oft falsche und manchmal richtige Entscheidungen trifft, immer aber eine ambivalente, zwiespältige Figur bleibt, die den Leser nie zur bequemen Identifikation einlädt.
Franz Schneider ist ein Bergmann aus Essen-Katernberg, und sein Schöpfer Hannes Köhler hat diesen Beruf nicht zufällig für ihn gewählt. Denn Schneiders Schicksal ist es, sich einen Lebensweg aus der brutalen geistigen und politischen Enge des Nationalsozialismus wie ein Verschütteter in eine freiere Welt graben zu müssen – über sich wie ein Berg die unermessliche deutsche Schuld und in sich die Sehnsucht nach Weite, Leichtigkeit und Offenheit. Als er als junger, hitlergläubiger Soldat in amerikanische Kriegsgefangenschaft gerät, erlebt er in der Landschaft von Texas und Utah eine Weite und Offenheit und in der Mentalität vieler Amerikaner eine Freiheit und Leichtigkeit, die ihn berauschen. Doch in beides einzutauchen gelingt ihm nicht, so sehr er es sich auch wünscht, denn seine Vergangenheit als Hitler-Soldat und als Kind der Nazi-Enge ist eben nicht tot, ja sie ist nicht einmal vergangen.
Der in der DDR berühmte, in Deutschlands Westen zu unrecht fast unbekannte Schriftsteller Franz Fühmann hat in seinen autobiographisch grundierten Büchern ein ähnliches Schicksal wie das von Franz Schneider beschrieben, auch wenn Fühmann nicht in amerikanische, sondern sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet. Wie Schneider konnten sich auch Fühmann zunächst schwer von seiner jugendlichen Hitlerverehrung lösen, wie für Schneider bedeuteten auch für Fühmann die deutschen Verbrechen eine schier unerträgliche moralische Mitverantwortung, wie Schneider erlebte auch Fühmann eine rasche und scheinbar umfassende politische Wandlung vom Nazi-Anhänger zum Nazi-Gegner, legte aber eine tiefergehende Dumpfheit, in die er als Hitler-Junge hineinerzogen und eine Verrohung, in die er als Wehrmachtssoldat hineingedrillt wurde, erst sehr viel später ab. (Meine kleine Fühmann-Monografie ist hier zu haben.)
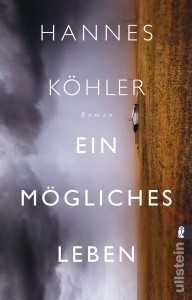
Hannes Köhler: "Ein mögliches Leben". Roman. Ullstein Verlag 2018
Hannes Köhler zeigt das alles in seinem Roman mit großartiger erzählerischer Genauigkeit. Wie Franz Schneider, unterstützt durch seinen Freund Paul, das eingeimpfte Nazi-Denken hinter sich lässt und den Krieg aus amerikanischer Perspektive zu sehen beginnt. Wie seine unbelehrbar hitlergläubigen Mitgefangenen ihn deshalb als Verräter ausgrenzen, verfolgen und bedrohen. Wie sein Freund Paul von solchen Unbelehrbaren im Lager ermordet wird, und er selbst nur überlebt, weil er sich vom amerikanischen Wachpersonal verhaften und in ein anderes Lager verlegen lässt.
Hätte Köhler jedoch nur dieses Kapitel von Schneiders Kriegsgefangenschaft geschildert, er hätte einen recht einseitigen, undifferenzierten Roman geschrieben. Die ungewöhnliche literarische Qualität seines Buches und auch die Menschen- und Geschichtskenntnis des Autors erweisen sich darin, was er vom zweiten Teil von Schneiders Gefangenschaft erzählt. Dass Schneider nämlich nach dem Tod seines Freundes Paul von Rachsucht nicht frei ist, dass er in dem neuen Gefangenenlager, in das er verlegt wird, frühzeitig Gleichgesinnte um sich schart, dass er mit ihnen gemeinsam die sturen Hitleranhänger unter den Mitgefangenen seinerseits ausgrenzt, verfolgt und bedroht und dass er sich schließlich an der Ermordung eines solchen Unbelehrbaren beteiligt. Er glaubt in diesem Moment, seine Nazi-Vergangenheit überwunden zu haben, aber in ihm ist diese Vergangenheit keineswegs tot, in ihm ist sie noch lange nicht vergangen, sondern sie wirkt – obwohl die politischen Vorzeichen ausgetauscht wurden – mit brutaler Unmenschlichkeit fort.
Geschichte geht nicht spurlos an uns vorüber, Hannes Köhler zeigt das in seinem Roman auf eindringliche Weise. Was Franz Schneider im Krieg und in der Gefangenschaft zugemutet wurde, hat manches in diesem Bergmann gleichsam zu Stein erstarren lassen. Bezeichnenderweise sammelt er kleine Steine, die er an den entscheidenden Orten seiner Biographie aufliest. Seine Persönlichkeit hat schroffe Bruchkanten, an denen sich selbst seine Familie üble Verletzungen zuziehen kann. Die menschliche Aufgeschlossenheit und Freiheit, die er an vielen Amerikanern bewundert, bleibt für ihn oft unerreichbar, zum Beispiel wenn es um Kritik an jenem geliebten Amerika geht. Als seine Tochter Barbara in den Jahren der Studentenbewegung gegen den Krieg der USA in Vietnam protestiert, reagiert er nicht mit Verständnis, sondern mit Ausgrenzung wie er sie im Gefangenenlager erfahren hat. Er wirft seine Tochter aus dem Haus, er verbannt sie mit steinerner Konsequenz aus seinem Leben und reicht so das Trauma der Ausgrenzung innerhalb der Familie an die nächste Generation weiter.
Sobald Köhlers Roman nicht mehr allein von Franz Schneider erzählt, sondern auch von seiner Tochter Barbara und seinem Enkel Martin, sobald er sich also zum Familienroman weitet, skizziert er zugleich etwas von der Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik in familiärem Maßstab. Barbara zum Beispiel ist keine stereotype, sondern glücklicherweise eine wohltuend unfanatische Achtundsechzigerin. Sie hat von frühester Kindheit an um die Aufmerksamkeit und Liebe ihres seltsam kühlen, distanzierten, erstarrten Vaters werben müssen. Nicht zuletzt deshalb hat sie wohl seine Begeisterung für amerikanische Literatur auch zu der ihren gemacht. Aber als sie von ihm mit fast alttestamentarischer Härte verstoßen wird, beginnt auch sie sich gegen ihren Vater zu verhärten und auf seine Ablehnung ihrerseits mit Ablehnung zu reagieren. Erst ihr Sohn Martin, der Enkel Franz Schneiders, ist von dieser Konfrontation biographisch weit genug entfernt, um Neugier auf die Geschichten seines Großvaters zu entwickeln und durch die gemeinsame Reise nach Amerika die Gespräche zwischen den Generationen wieder in Gang zu bringen.
Doch das ist längst nicht alles, Köhler macht wie nebenbei auch andere mentalitätsgeschichtliche Entwicklungen spürbar. Als Franz Schneider aus der Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurückkehrt, dort eine Frau kennenlernt und sie schwängert, ist für beide selbstverständlich klar, dass sie heiraten müssen. Es ist eine Ehe, in der oft das Schweigen herrscht und die von Ausbruchsphantasien begleitet wird, die aber für beide einen felsenfesten, steinernen Bestand hat. Für ihre Tochter Barbara ist die Ehe dann nur der äußere Rahmen für eine Liebe, die sie mit ihrem Mann verbindet. Als die Liebe verschwindet, gibt sie ganz selbstverständlich auch die Ehe auf. Für den Enkel Martin wiederum scheint Sex kein großes Thema zu sein, jede Andeutung einer festeren Bindung jedoch ein erhebliches Problem. Als er nach einem One-Night-Stand Vater wird, schließt er das Kind sofort ins Herz, aber es braucht einen ungeheuer langen und windungsreichen Weg, bevor er auch seiner Zuneigung zu der Mutter des Kindes die Chance des Zusammenlebens gibt.

Hannes Köhler, Foto Copyright Gerald von Foris
„Die Vergangenheit ist niemals tot“, schreibt William Faulkner, „sie ist noch nicht einmal vergangen.“ Sie wirkt in uns fort, sie beherrscht uns oft stärker, als wir es selbst wissen. Und das bedeutet zugleich, wir können vieles an anderen Menschen, mehr noch: wir können vieles an den Menschen in der eigenen Familie erst richtig verstehen, wenn wir ihre Vergangenheit zu verstehen beginnen. Hannes Köhlers Roman erzählt von der langen Reise eines Enkels in die Vergangenheit seines Großvaters. Er erzählt nicht nur davon, dass der Enkel seinen Großvater daraufhin besser begreift, sondern auch davon, dass der Großvater die eigene Geschichte mit anderen Augen zu betrachten beginnt und zum ersten Mal versucht, sich seiner Tochter zu erklären. Dieses wiederbegonnene Gespräch nach Jahren des Schweigens wird nicht alle Wunden heilen, machen wir uns nichts vor, manche Wunden sind zu tief, sie verschwinden nicht, sie können allenfalls vernarben. Aber ein wiederbegonnenes Gespräch eröffnet Chancen: auf mehr Verständnis, auf mehr Milde im Umgang oder gar auf Bereitschaft zur Vergebung. Und diese Bereitschaft gehört wohl zu dem, von dem wir sprechen, wenn wir von Familie sprechen.
Wie sorgsam und liebevoll Hannes Köhler seinen Roman „Ein mögliches Leben“ gebaut hat, zeigt sich vor allem an den Details seiner Geschichte. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, Franz Schneider habe sich in der Abstellkammer seines Reihenhäuschens ein Arbeitszimmer eingerichtet, um dort amerikanische Romane zu lesen und seiner Träume von der Weite und Offenheit Amerikas zu träumen. Für mich ist das ein ungeheuer intensives Bild: Ich stelle mir diese Abstellkammer eng vor, bedrückend und lichtlos. Der frühere Bergmann Franz Schneider muss sich dort gefühlt haben, als kehre er in die finsteren, engen Stollen zurück, in denen er einst arbeitete. Von realer Offenheit und Weite keine Spur.
Vielleicht darf ich abschließend einen kleinen literarischen Wunsch in diese Lobrede einflechten. Ich weiß natürlich nicht, welche Bücher Franz Schneider in seinem winzigen Arbeitszimmer gelesen hat, Hannes Köhler deutet nur seine Begeisterung für Hemingway und Faulkner an. Doch ich wünschte mir, es wäre auch „The Great Gatsby“ darunter gewesen, jener grandiose Roman von Scott Fitzgerald, der von einem Mann erzählt, der aus einem Weltkrieg zurückkehrt. Es ist ein anderer Krieg als der, aus dem Franz Schneider zurückkehrt, aber das ist egal. Auch Gatsby hat Verletzungen davongetragen, die niemand recht begreifen kann, der den Krieg nicht erlebt hat. Und auch Gatsby scheitert an dem Versuch, sich von dieser Vergangenheit zu lösen und in eine neue, offene, freie Zukunft zu treten. Und falls Franz Schneider, wie ich es mir wünschte, irgendwann „The Great Gatsby“ gelesen haben sollte, dann dürfte ihm vielleicht der ebenso wunderbare wie erschütternde Satz aufgefallen sein, den Fitzgerald an den Schluss seines Romans gestellt hat: „So kämpfen wir weiter“, heißt es da, „ so kämpfen wir weiter, wie Boote gegen den Strom, und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit.“
Lieber Hannes Köhler, Sie haben ein sehr kluges, verständnisvolles, sehr beeindruckendes Buch geschrieben. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Roman, und ich gratuliere Ihnen zum Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.