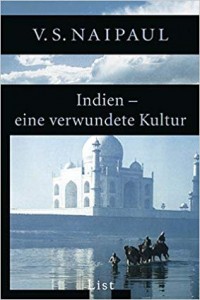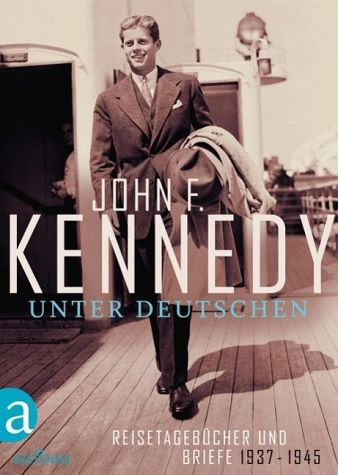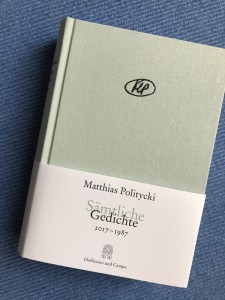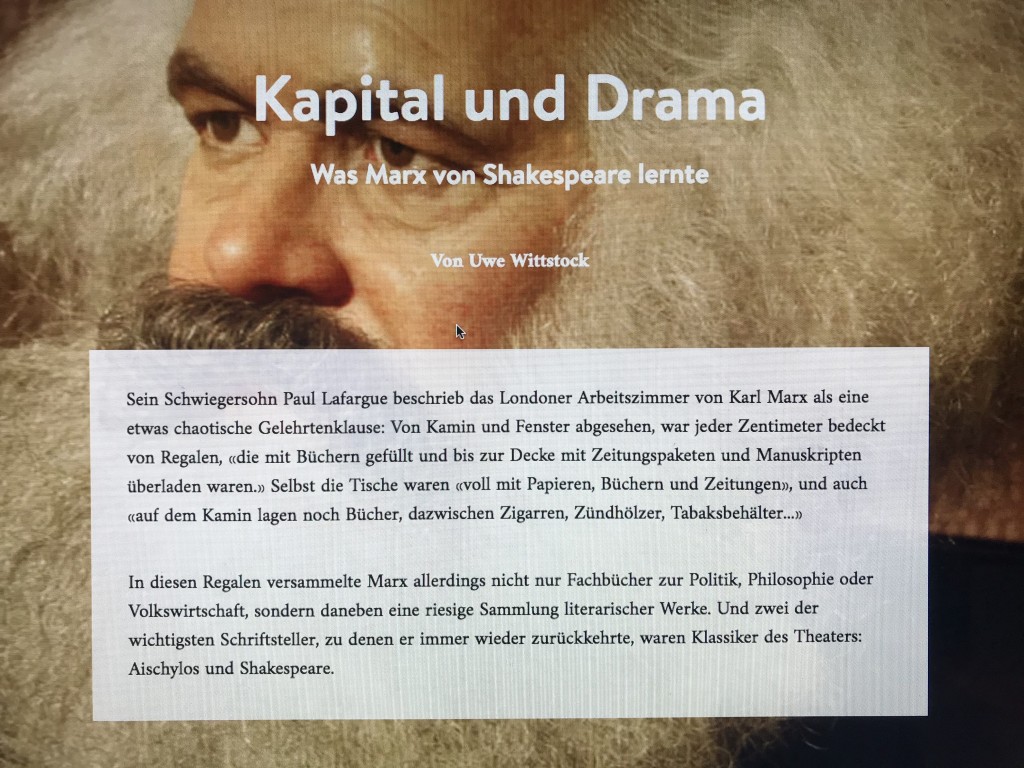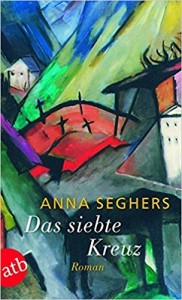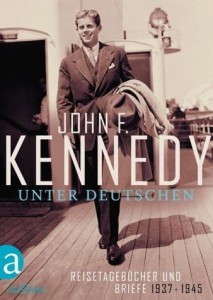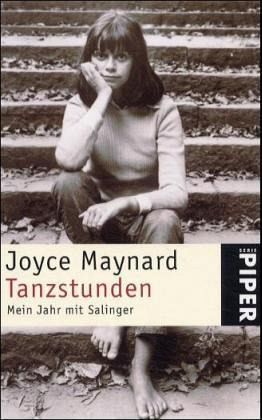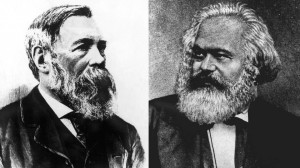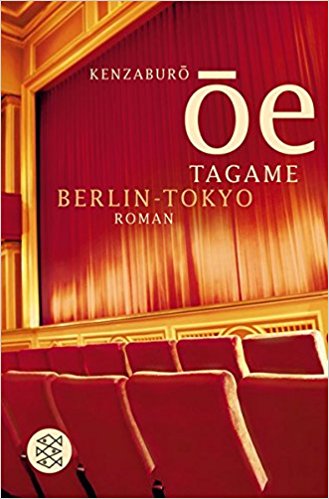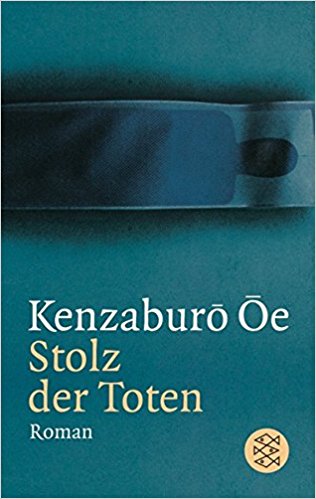Ein Mann mit mindestens drei Gesichtern
Gestern, am 11. August 2018 starb der Literatur-Nobelpreisträger V.S. Naipaul in London. Er galt als einer der größten englischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. 1932 in Trinidat als Nachkomme verarmter indischer Wanderarbeiter geboren, hatte er den atemberaubenden Weg eines “Barfüßigen aus der Kolonie” bis hin zu einem Mitglied der Oberklasse in England erfolgreich bewältigt. Naipaul erhielt nicht nur einige der begehrtesten Literaturpreise, sondern 1990 auch den Adelstitel. Seither durfte er sich Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul nennen, zeichnete seine Bücher aber weiterhin mit der kappen Chiffre: V.S. Naipaul.
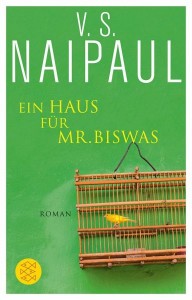
V.S.Naipaul: "Ein Haus für Mr. Biswas". Roman. Übersetzt von Sabine Roth. Fischer Taschenbuch Verlag, 12,99 Euro
Der Schriftsteller V. S. Naipaul hatte mindestens drei Gesichter. Er war zu Anfang seiner literarischen Karriere ein Erzähler von großem Atmen und beeindruckender Suggestivität. Zwei seiner Romane – “Ein Haus für Mister Biswas” (1961) und “In der Biegung des großen Flusses” (1979) – gehören zu dem Eindrucksvollsten was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über die fragilen, von ihren ehemaligen Kolonialherren in eine krisengeschüttelte Freiheit entlassenen Gesellschaften der Dritten Welt geschrieben wurde. In Anspielung auf seine Herkunft erklärte Naipaul, als er 2001 den Literaturnobelpreis erhielt: “Ich bin höchst erfreut. Dies ist eine große Anerkennung für England, meine Heimat, und für Indien, die Heimat meiner Vorfahren.”
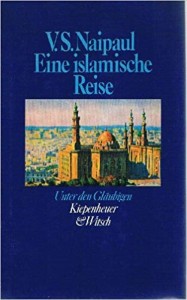
V.S.Naipaul: "Eine islamische Reise". Unter den Gläubigen.Übersetzt von Karin Graf. Derzeit nur als dtv-Taschenbuch lieferbar
Zweitens war der 1932 auf Trinidad als Nachkomme eingewanderter indischer Landarbeiter geborene Naipaul ein Reiseschriftsteller von internationalem Rang. Schon in jungen Jahren, nach der Veröffentlichung seiner ersten drei satirischen Frühwerke, die er selbst als “soziale Komödien” bezeichnete, nahm Naipaul eine ausgedehnte und weitschweifende Reisetätigkeit auf. Wie nur wenige andere Autoren – zumal wie sehr wenige deutschsprachige Schriftsteller – eroberte er sich auf diese Weise weite Erdteile und fremde Zivilisationen durch eigene Anschauung. Als literarischer Erträge brachte er von diesen Expeditionen epische Reportagen mit, die wie “The Middle Passage” (1962), “Indien: Eine verwundete Kultur” (dt. 1978) oder “Eine islamische Reise. Unter den Gläubigen” (dt. 1982) zu dem Anschaulichsten und Informativsten zählen, was man über die Karibik, Indien und die islamischen Länder lesen kann. Zu den Eigentümlichkeiten des deutschen Buchmarktes gehört, das derlei literarische Reisebeschreibungen – auch Naipauls – hierzulande nur sehr wenige Leser finden, obwohl die Deutschen sich doch so gern als überaus reise- und leselustiges Volk betrachten.
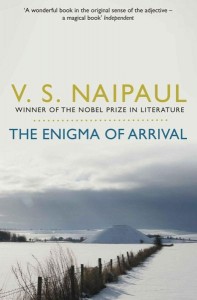
V.S.Naipaul: "The Enigma of Arrival" Novel (dt.: "Das Rätsel der Ankunft") Macmillan Publishers International, 9,99 Euro
Drittens schließlich hat sich Naipaul mit zunehmendem Alter zu einem explizit modernen, vielfältig experimentierenden Prosaautor entwickelt, der sich von seinem früheren traditionellen Schreiben fast demonstrativ abwandte. In “Das Rätsel der Ankunft” beispielsweise beschreibt Naipaul über viel hundert Seiten hinweg im Grunde nichts anderes als ein kleines Tal östlich von London, wo er in einem kleinen, feuchten Landhaus jahrelang lebte und schrieb. Ein Buch, dass man eher einem Autor des französischen “Nouveau Roman” zugetraut hätte, als einem ehemals so lebendig und temperamentvoll erzählenden Romancier oder einem politisch kühl analysierenden Reporter zugetraut hätte.
Seinen internationalen Ruhm begründete Naipaul mit dem Roman “Ein Haus für Mister Biswas”, der in seiner karibischen Heimat und den Kampf eines einfachen, aber ambitionierten eingewanderten Inders beschreibt, der das kühne Lebensziel verfolgt, mit seiner Familie ein wirtschaftlich selbständiges und zugleich kultiviertes Leben zu führen. Mit diesem autobiografisch gefärbten Roman setzte Naipaul seinen Vater, der sein Leben lang darum rang, ein Journalist und Schriftsteller zu werden, immer aber an den erbärmlichen Lebensbedingungen Trinidads scheiterte, ein menschlich anrührendes, unvergessliches Denkmal.
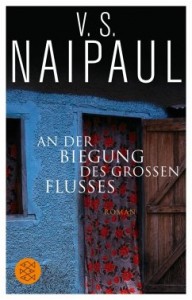
V.S.Naipaul: "An der Biegung des großen Flusses". Roman. Übersetzt von Sabine Roth. Fischer Taschenbuch Verlag, 14,99 Euro
Wie beweglich Naipauls literarische Fantasie ist, wie unabhängig von spezifischen Milieus oder Landschaften er zu erzählen vermag, bewies er rund 15 Jahre später, als er mit dem Roman “An der Biegung des großen Flusses” das Porträt einer afrikanischen Gesellschaft schrieb, in der sich ein Einwanderer als Geschäftsmann einen festen Lebensplatz zu erobern versucht. Seine jahrelange Arbeit, seine intensiven Anpassungsbemühungen und auch seine so behutsam angeknüpften Liebesbande zu einer ihm unerreichbar erscheinenden Frau werden kurzer Zeit zunichte gemacht, in der gewalttätige Rassenunruhen die wenigen, mühsam herausgebildeten zivilisatorischen Strukturen in diesem Land hinwegschwemmen.
Wegen seines gnadenlosen Blickes nicht nur auf die Schwächen der Ersten Welt, sondern auch auf die der Dritten Welt ist Naipaul oft heftig angegriffen worden. Sein Fazit, nachdem er als Collegelehrer in den USA gearbeitet hatte: “Ungebildete Studenten mit weißen Söckchen bedrohen Amerika mehr als Öl-Embargos”. Über seine britische Wahlheimat schrieb er: “Das Leben hier ist eigentlich eine Art Kastration. In England sind die Leute sehr stolz darauf, dumm zu sein.” Und nach einer seiner Afrikareise schrieb er: “Die Leute sagen, der Mann im Busch ist ausgebeutet worden, ist ein Opfer des Kolonialismus. Ich dagegen glaube, dass die Menschen in Europa viel größere Ungewissheiten und Gewalt ertragen haben als je ein Mensch, der im Busch lebt. Ich bin erstaunt über die Kreativität in Europa. Unkreative Länder, das sind doch wohl die arabischen Länder und Afrika. Sie tun nichts, das sind parasitäre Orte.”
Naipaul war kein Mann der politisch ausgewogenen, begütigenden Äußerung. Doch er konnte seinen Furor stets mit großer Kompetenz und Lebenserfahrung rechtfertigen: Er kannte, wovon es sprach und konnte sein Urteil durch eigene Erlebnisse untermauern. Naipaul, der vom namenlosen Sohn verarmter indischer Eltern auf einer verlorenen Karibikinsel aus eigener literarischer Kraft zu einem Kosmopoliten und weltweit anerkannten Autor geworden war, legt unerbittliche Maßstäbe an. Dass ihn das zu einem sanftmütigen Menschen machte, wird niemand behaupten. Er sei ein glänzender Schriftsteller, gestanden ihm viele seiner Kritiker zu, aber eben auch ein Mann mit einem schwierigen Charakter.
Naipaul schonte nichts und niemanden – aber am wenigsten sich selbst. Er war ein fanatischer Arbeiter, der seine Manuskripte, nachdem sie getippt waren, mehrfach mit der Hand abschrieb, um so an jedem Satz, an jeder Formulierung erneut zu feilen – mitunter bis zum körperlichen Zusammenbruch. Auf diese Weise wurde er im buchstäblichen Sinn des Wortes ein freier Autor: “Das hat mit die Unabhängigkeit bewahrt”, schrieb er einmal, “von Leuten, von Verstrickungen, von Rivalitäten, vom Wettbewerb. Ich habe keine Gegenspieler, keine Rivalen, keine Meister: Ich fürchte niemanden.”
Gerade zu Beginn des neuen Jahrtausends und nach den Terroranschlägen vom 11. September – V. S. Naipual den Literaturnobelpreis zu verleihen, war mehr als eine literarische Entscheidung. Es war eine politische Demonstration: Für einen in vielen Kulturen erfahrenen Mann, der ohne Scheuklappen auf seine Epoche sah und der ohne Ärmelschoner schrieb und dachte. Für eine Mann, der – auch schmerzvoll – die Globalisierung sämtlicher Lebensverhältnisse schon Jahrzehnten zuvor am eigenen Leibe erfahren hatte. Und nicht zuletzt für einen Schriftsteller, der in der literarischen Tradition Europas den Lesern aller Kontinente mit hinreißender erzählerischer Anschaulichkeit von scheinbar entlegene Weltgegenden berichtet hatte, und der dort letztlich die gleichen Hoffnungen, die gleichen Schmerzen, die gleichen Träume, kurz: die gleichen Menschen entdeckt, die alle großen Romane bevölkern. V.S. Naipaul hat den Horizont unserer Literatur um ein gutes Stück ins Unbekannte vorangeschoben.