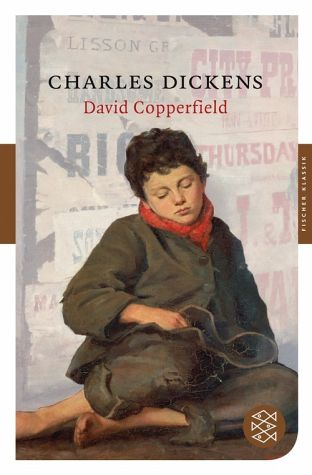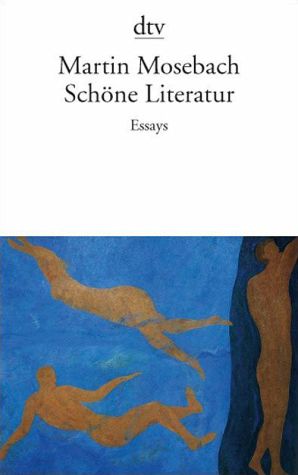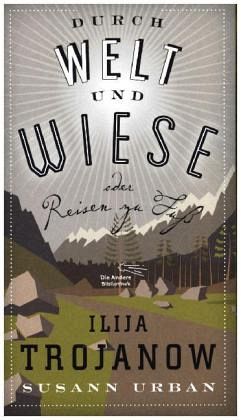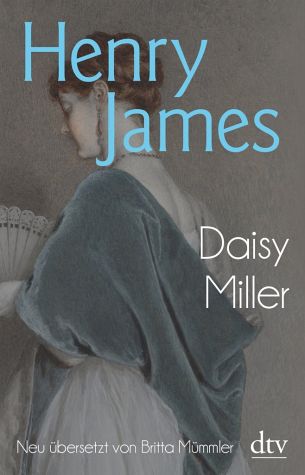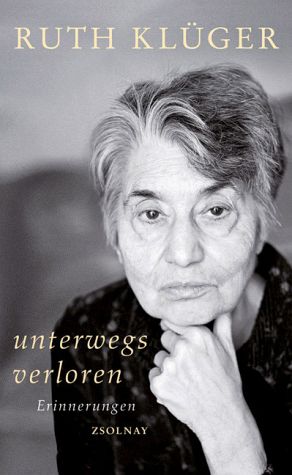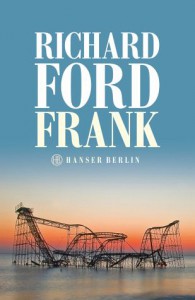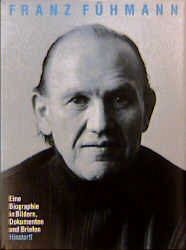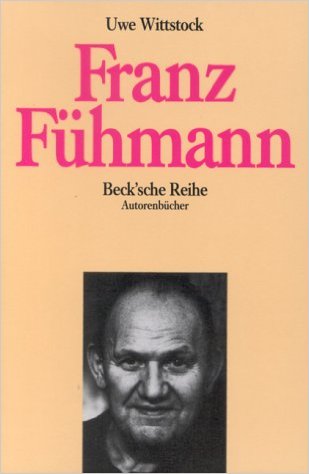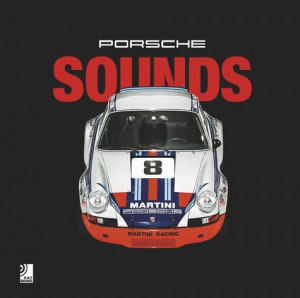”Vor allem: keine Psychologie!”
Ein Gespräch mit dem Erzähler Martin Mosebach über den gigantischen Erfolg des Erzählers Charles Dickens, der heute Geburtstag hat: Weshalb seine Romane das Vorbild für Entenhausen sind, warum er zwar die Kinderarbeit seiner Zeit anprangerte, aber über die Kinderprostitution kein Wort verlor und wieso er die Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft besser verstanden hatte als Karl Marx
Uwe Wittstock: Dickens’ Erfolg ist gigantisch. Seine Bücher haben eine Gesamtauflage von mehreren hundert Millionen. „Oliver Twist“ wurde mehr als 20-mal verfilmt, noch häufiger die Weihnachts-Geistergeschichte um den herzlosen Scrooge. Was macht diese literarische Anziehungskraft aus?
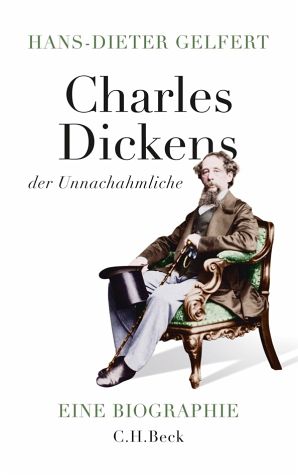
Hans-Dieter Gelfert: "Charles Dickens, der Unnachahmliche". Eine Biografie. Verlag C.H. Beck, 14,95 Euro
Martin Mosebach: Die berühmten Romane „Oliver Twist“ und „David Copperfield“ oder auch die „Weihnachtsgeschichte“ haben den Welterfolg des Genres Jugendliteratur erst eigentlich möglich gemacht. Ihr Rezept: eine klare Trennung zwischen bösen und guten Charakteren und dazu einen jungen Helden, der sich als Identifikationsfigur anbietet. Jeder Jugendliche, der sich einsam, unverstanden und also unglücklich fühlt – wie man das als junger Mensch gelegentlich tut -, findet in diesen Romanen ein literarisches Gegenüber, in das er sich einfühlen kann. Und am Schluss siegt das Gute. Der junge Held triumphiert, die Sehnsucht junger Leser nach Anerkennung und Größe erfüllt sich. Die zahllosen jugendlichen Helden in den Jugendbüchern des 20. Jahrhunderts sind Enkel und Urenkel von Oliver Twist.
Wittstock: Zugleich sind Dickens’ Romane sehr komisch.
Mosebach: Ja, das bunte Personal, das die Helden in Dickens’ Romanen umgibt, ist immer wieder hinreißend. Dickens hat die Figuren der italienischen Commedia dell’Arte und der altenglischen Weihnachtspantomime in die Prosaliteratur eingeführt und mit dem Gesellschaftsroman verschmolzen. Er hatte eine unerschöpfliche Fantasie, wenn es darum ging, kauzige, kuriose, witzige Nebenfiguren zu erfinden. Aber auch gruselige, erschreckende, beängstigende Gestalten. Er hat damit ein bis in unsere Gegenwart vielfach benutztes Erzählmodell entwickelt. Ganze Comic-Welten wie Disneys Entenhausen oder das Springfield der Simpsons folgen diesem Muster: Um eine Zentralfigur schart sich ein Ensemble von drolligen, leicht wiedererkennbaren Typen, die in bunter Folge auf- und wieder abtreten und so ein komisches Milieu erschaffen. Vor allem: keine Psychologie! Stattdessen: Typen- und Maskentheater! Auch „Harry Potter“ geht letztendlich auf Charles Dickens zurück: der jugendliche Held, umgeben von einer schier unüberschaubaren Menge bizarrer oder eben schauerlich-fantastischer Nebenfiguren.
Wittstock: Anders als J. K. Rowling war Dickens ein ausgesprochen sozialkritischer Autor. Das Bild von der Not der Arbeiter im Manchester-Kapitalismus ist maßgeblich von Dickens mitgeformt worden.
Mosebach: Dickens hatte die Schattenseiten seiner Zeit am eigenen Leib erfahren. Er erlebte den sozialen Abstieg seiner Familie, als sein Vater ins Schuldgefängnis kam und er als Zwölfjähriger für zehn Stunden täglich zur Arbeit in eine Schuhwichsfabrik geschickt wurde. Er sah die gnadenlose Welt der Armen mit den Augen des abgestiegenen Bürgerlichen, der diesen Abstieg als Schande empfindet. Die Erinnerung an diesen realen Albtraum hat ihn zeitlebens nicht verlassen.
Wittstock: Hat Dickens mit seinen Büchern zur Einschränkung der Kinderarbeit beigetragen?
Mosebach: Nicht nur mit seinen Büchern. Er polemisierte in zahllosen Zeitungsartikeln gegen die Lasten, die man in seiner Zeit den Kindern auflud. Andererseits hat er in seinen Romanen bestimmte Themen konsequent ausgespart: Die ganze Welt der Erotik und des Sexus zum Beispiel kommen bei ihm nicht vor. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in England ja nicht nur das Elend der Arbeitshäuser, in denen Oliver Twist fast umkommt. Vollständig wäre das Bild der Epoche erst, wenn Dickens auch die aus der Armut geborene Kinderprostitution beschrieben hätte, die damals an der Tagesordnung war. Dostojewski hat das gewagt. Doch die viktorianische Gesellschaft war zu prüde, um so etwas offen zur Sprache zu bringen. Auch damals gab es Sextourismus: Allerdings musste der Gentleman der englischen Middle Class nicht auf andere Kontinente reisen, sondern nur in die Armenviertel Londons.
Wittstock: Aber Dickens war kein Ideologe. Er hätte Karl Marx im London seiner Zeit treffen können, aber marxistische Ideen waren im völlig fremd.
Mosebach: Die gesellschaftliche Ordnung wird in seinen Romanen nie in Frage gestellt. Letztlich war das soziale Elend viel größer, als er es schilderte. Dickens war kein Zola, er beschrieb das Elend so abgemildert, dass seine Leser es gerade noch ertragen konnten. Und die Lösung seiner Romane ist immer, dass zum guten Ende wohlhabende, gütige Menschen den Armen helfen und ihnen ihr Los erleichtern, nachdem vorher viele hartherzig weggeschaut haben. Auf diese Weise hat Dickens an das Gewissen seiner Leser appelliert. Man darf nicht vergessen: Marx rechnete fest mit einer proletarischen Revolution in England. Dickens’ Romane dagegen zielten darauf, das soziale Verantwortungsgefühl der bürgerlichen Leser zu schärfen. Er ist das literarische Pendant zum Tory-Premierminister Disraeli und seinem konservativen Paternalismus. Allerdings hatten die Engländer damals Kolonien, in die sie einen Teil ihrer sozialen Probleme verlagern konnten.
Wittstock: War Dickens also ein Moralist?
Mosebach: Er glaubte fest an eine Kombination aus Vernunft und gutem Herzen. Man kann das naiv nennen. Aber es lag in diesem Glauben, so wie Dickens ihn in seinen Romanen ausgesprochen hat, zweifellos eine Kraft – auch politisch. Die Doktrin, die er erzählend propagiert hat, lautete: Gutsein lohnt sich. Man darf ihn deshalb wohl einen Moralisten nennen, denn er warb eben nicht für utopische Ziele, sondern für eine Linderung konkreter Leiden, die letztlich im Interesse der gesamten Gesellschaft lag. Rückblickend könnte man sagen: Dickens hat die Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft besser verstanden als Karl Marx.