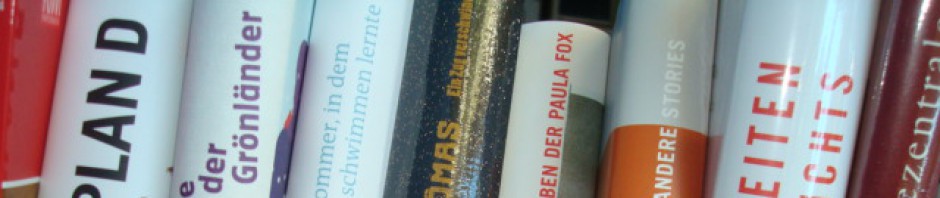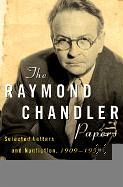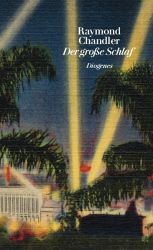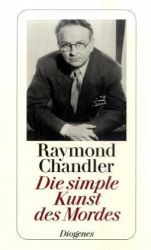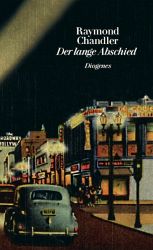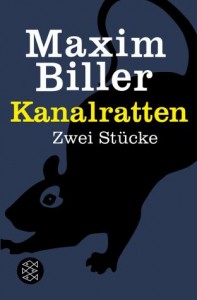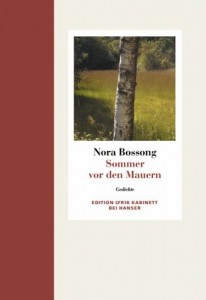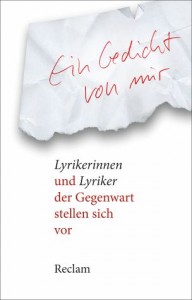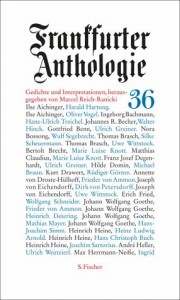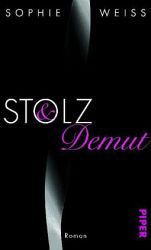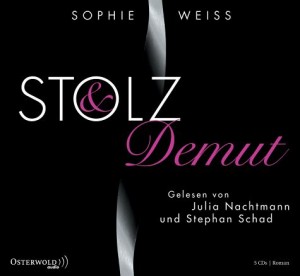Antike Eifersucht und das Zeitalter des Smartphones
Okay, ich gebe zu, ich lese nicht jeden Tag einen Lyrikband. Aber doch ab und zu gern ein Gedicht. In der schönen Anthologie Ein Gedicht von mir zum Beispiel fiel mir Nora Bossongs “Leichtes Gefieder” auf. Im ersten Moment verstand ich das Gedicht nicht und ärgerte mich. Dann ließ ich mir von Google weiterhelfen und nahm von einem lieben, aber altersschwach gewordenen literarischen Vorbehalt Abschied. Doch der Reihe nach: Erst einmal bat ich die Autorin um die Erlaubnis, ihr Gedicht aus dem Band Sommer vor den Mauern hier – ja, was? abzudrucken, ist in Netz wohl das falsche Wort – es hier vorzustellen. Sie gab sie mir. Vielen Dank Nora Bossong! Zunächst also die 17 Zeilen ihres Gedichts:
Nora Bossong: Leichtes Gefieder
Vielleicht zu spät, als eine Krähe
unseren Morgen kappt. Ein Schlag.
Und ob sie fällt und ob sie weiterfliegt -
Ich frag zu laut, ob du noch Kaffee magst.
Dein Blick ist schroff, wie aus dem Tag gebrochen.
Es riecht nach Sand. Du fragst mich, ob ich wisse,
dass Krähen einmal weiß gefiedert waren.
Ich lösch die Zigarette aus, ich wünsch mich
weg von hier, ich möchte niemanden,
ich möchte höchstens einen andern sehen.
Du nennst mich: Koronis. Ich zeig zum Fenster:
Sieh doch, die Aussicht hat sich nicht verändert!
Was gehen dich die Stunden an, die du nicht kennst?
Ich will nur Mädchen sein, nicht in Arkadien leben.
Dein Nagel scharrt noch in der Asche,
doch du bist still, als wärst du fort.
Ich bin zu leicht für deine Mythen
Das ist ein verdammt ungemütliches Frühstück, von dem Nora Bossong hier berichtet. Es gibt sogar – wie in der Literatur so oft und so selten im Leben – ein finsteres Vorzeichen, bevor der Streit beginnt. Mit einem „Schlag“ platzt eine Krähe in den Morgen, und Krähen galten schon den Auguren Roms, die aus dem Vogelflug und -geschrei die Zukunft zu prophezeien hatten, als mögliche Unglücksboten.
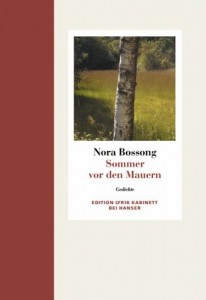
Nora Bossong: „Sommer vor den Mauern“. Gedichte. Edition Lyrik Kabinett bei Carl Hanser Verlag, München 2011, 96 S., geb., 14,90 Euro
Doch die Krähe flattert nicht allein wegen ihrer Symbolkraft in diesem Gedichtanfang herum, sondern auch als ganz reales Unfallopfer. Wer je an einem Fenster saß, gegen das plötzlich ein Vogel prallte, weiß, wie schockierend so ein vergleichsweise kleines Alltagsunglück wirken kann, nicht zuletzt weil sich aus heiterem Himmel mit aller Brutalität die Frage nach Leben und Tod stellt, wenn man schaut, ob das Tier „fällt“ oder „weiterfliegt“.
Aus zuvor scheinbar heiterem Himmel entgleist in dem Gedicht auch das Gespräch des Paares: Sie fragt „zu laut“, ob er noch Kaffee mag, sein Blick wird „schroff“, sie wünscht sich „weg von hier“. Doch was zwischen den beiden vorgefallen ist, bleibt unausgesprochen. Verschlüsselte Hinweise geben nur seine Bemerkung, „dass Krähen einmal weiß gefiedert waren“, und der neue Beiname, den er ihr gibt: „Koronis“.
Koronis gehört nicht zu den weithin bekannten Gestalten der griechischen Mythologie. Und das war der Punkt, an dem ich mich anfänglich ärgerte. Denn offen gestanden kamen mir solche exklusiven literarischen Anspielungen lange Zeit allzu bildungsfroh vor, so als würden Autoren bewusst die Augen vor der Einsicht zukneifen, wie wenige Leser sie tatsächlich entschlüsseln können. Sollten Gedichte, sollte Literatur nicht ohne kommentierende Anhänge oder Fußnoten verständlich sein? Ist die Gelehrsamkeit, die ein Autor mit derlei Belesenheitssignalen demonstriert, nicht zugleich ein Versuch, das Publikum unstatthaft einzuschüchtern?
Doch, wie gesagt, dann erinnerte ich mich, dass diese Bedenken sich im Zeitalter des Smartphones weitgehend erledigt haben. Solange wir uns innerhalb der Reichweite elektronischer Netze bewegen, gibt es heute kein Bildungszitat mehr, das einen Leser noch lange rätseln lassen muss. Nur Sekunden, und ich hatte alles über Koronis erfahren: Dass Apoll es war, der sie liebte, sie schwängerte und durch eine weißen Krähe bewachen ließ. Dass Koronis sich davon aber nicht abhalten ließ, mit einem anderen Mann zu schlafen, weshalb Artemis sie tötete und Apoll die Krähe dazu verdammte, schwarz zu sein, da sie versäumt habe, der untreuen Geliebten rechtzeitig die Augen auszuhacken.
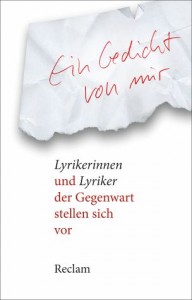
"Ein Gedicht von mir". Lyrikerinnen und Lyriker stellen sich vor. Herausgegeben von Dirk von Petersdorff. Reclam Verlag, Stuttgart 2012. 160 Seiten, 10 Euro
Damit liegt auf der Hand, was dem Paar in diesem Gedicht den Morgen und vielleicht nicht nur den Morgen verdirbt. Ein Abstecher des Mädchens in das Bett eines anderen Mannes. Sie versucht ihren Freund zu beruhigen, zwischen ihnen könne alles beim Alten bleiben: „Sieh doch, die Aussicht hat sich nicht verändert! / Was gehen dich die Stunden an, die du nicht kennst?“ Aber vermutlich glaubt sie selbst nicht ganz an das, was sie da sagt. Denn schon in den Zeilen zuvor ist wohl nicht zufällig davon die Rede, dass sie eine Glut erstickt („Ich lösch die Zigarette aus“) und sich längst fehl am Platze fühlt: „Ich wünsch mich / weg von hier, ich möchte niemanden, / ich möchte höchstens einen andern sehen.“
Ihre Begründung für die Freiheit, die sie sich nimmt, klingt im ersten Moment ein wenig nach kindlich naivem Trotz: „Ich will nur Mädchen sein, nicht in Arkadien leben.“ Aber genauer betrachtet steckt hinter der Entschlossenheit, mit der sie hier die in antike Gewänder gehüllte Eifersucht ihres Freundes zurückweist, mehr als eine backfischhafte Laune. Denn wer seine treulose Geliebte Koronis nennt, sieht sich selbst offenbar in der Rolle Apolls, also eines Gottes. Eine Haltung, die manches über ihn und seinen Blick auf die Freundin verrät.
Nicht zuletzt dieser überraschende kleine Perspektivwechsel, der einen als Leser erkennen lässt, wie sich hier jemand selbst entlarvt, hat mir dann besonders gefallen an Nora Bossongs Gedicht. Demonstriert er doch genau das, was mir so lange an allzu erlesenen literarischen Bildungszitaten auf die Nerven ging: nämlich welcher Autoritätsanspruch sich gelegentlich hinter derlei Anspielungen auf umfassende Gelehrsamkeit verbirgt.
Kein Wunder also, wenn sich die letzten drei Zeilen wie eine gründliche Abrechnung mit dem betrogenen Freund lesen lassen: Ihm bleibt nur noch, „in der Asche“ jener Glut zu scharren, die seine Geliebte sieben Zeilen zuvor gelöscht hat, und „still“ auf die Kraft seiner Worte verzichten, mit der er die Machtverhältnisse zwischen ihnen zu klären versuchte. Und wenn sie zum Abschluss feststellt: „Ich bin zu leicht für deine Mythen“, dann lässt sie darin geradezu triumphal ihre Selbstcharakterisierung als „leichtes Mädchen“ anklingen, mit der sie ihre Unabhängigkeit vom Gewicht seiner Gelehrtheit erklärt.
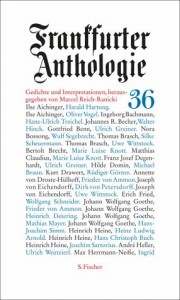
"Frankfurter Anthologie 36". Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki. S.Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013. 318 Seiten, gebunden. 24,99 Euro
Der Germanist Wulf Segebrecht hat sich ebenfalls mit Nora Bossongs “Leichtem Gefieder” beschäftigt. Er schrieb für den gerade erschienenen Band Frankfurter Anthologie 36 (Seite 232-234) eine kleine Interpretation dazu. Auch wenn ich Segebrecht als Lyrikfachmann sehr respektiere, muss ich doch eingestehen, dass ich in diesem Fall nicht mit ihm einverstanden bin. In seinem Kommentar klingt es so, als würde sich das Paar in dem Gedicht grundlos in die Haare geraten und der Mann seine Freundin mehr oder wenige ohne Anlass als Koronis titulieren: “Emport weist die junge Frau die unverschämte Identifikation mit der untreuen Koronis zurück. Mit Blick auf den erlebten Vorfall am Fenster behauptet sie, es habe sich dadurch doch gar nichts so verändert, dass ihr Partner daraus das Recht ableiten könne, auf ihre früheren, ihm gar nicht bekannten Verhältnisse und Beziehungen und vielleicht sogar auf eine bestehende Schwangerschaft anzuspielen. Sie will als eine eigene Person, als gegenwärtiges Mädchen, nicht als vergangene mythologische Figur aus dem antiken Sehnsuchtsland Arkadien wahrgenommen werden.”
Segebrecht nimmt hier, finde ich, den eigentlichen Zündstoff aus dem mythologischen Vorwurf heraus, den der Mann da am Frühstückstisch macht. Denn Koronis hat ja mit einem anderen Mann geschlafen, während Apoll sich als ihr Geliebter betrachtete und daraus gewisse Ausschließlichkeitsansprüche glaubte ableiten zu dürfen. Wenn Segebrecht schreibt, die junge Frau wolle nicht “auf ihre früheren, ihm gar nicht bekannten Verhältnisse und Beziehungen” angesprochen werden, macht er die Sache, die hier verhandelt wird, harmloser als sie ist. Nein, hier geht es meines Erachtens eindeutig um Untreue, um eine Entdeckungsreise zu einem anderen Liebhaber und darum, dass der Mann in den Augen des Mädchens eben kein Gott ist, sich also gefälligst mit ihrem Freiheitsbedürfnis abfinden soll: “Was gehen dich die Stunden an, die du nicht kennst?”
 Eine Menge Kollegen und Autoren haben mitgemacht und mitgeschrieben: Ellen Daniel, Elke Hartmann-Wolff, Elke Heidenreich, Barbara Jung, Ralf-Peter Märtin, Matthias Matting, Harald Pauli, Iris Röll und Lisa Timm. Als Art-Direktorin hat Susanne Achterkamp das Projekt begleitet. Großen Dank an alle.
Eine Menge Kollegen und Autoren haben mitgemacht und mitgeschrieben: Ellen Daniel, Elke Hartmann-Wolff, Elke Heidenreich, Barbara Jung, Ralf-Peter Märtin, Matthias Matting, Harald Pauli, Iris Röll und Lisa Timm. Als Art-Direktorin hat Susanne Achterkamp das Projekt begleitet. Großen Dank an alle.