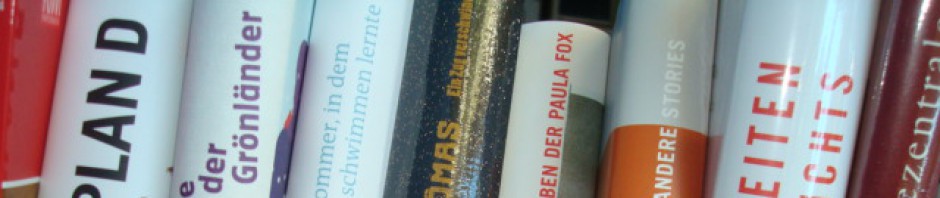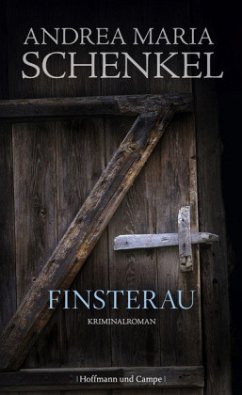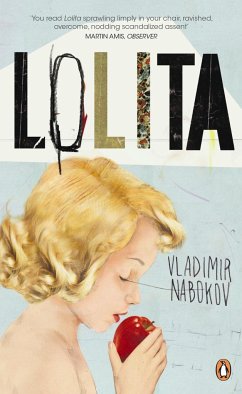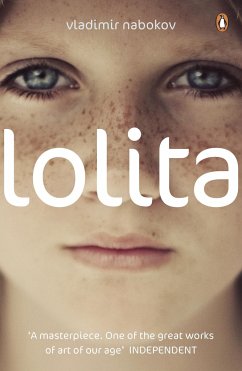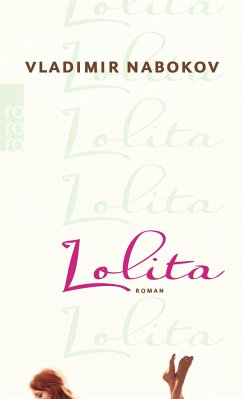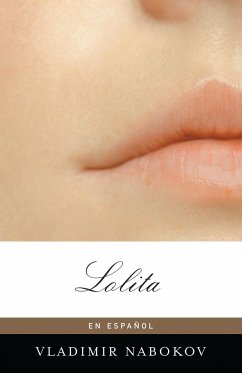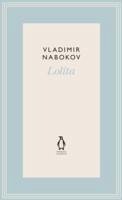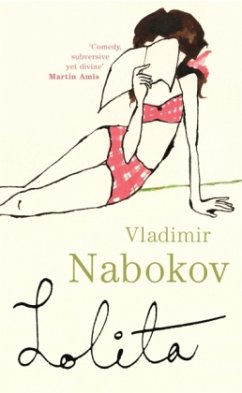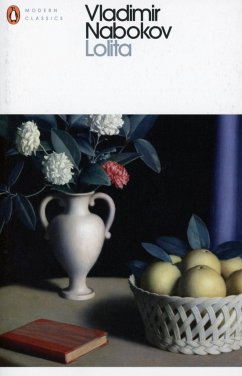Über die Gegenwart Schreiben? Nicht ohne meinen Anwalt!
Das Urteil gegen Maxim Billers Roman Esra hat einschneidende Folgen für alle Schriftsteller. Alleine 2011 konnten drei deutsche Romane nach juristischen Einsprüchen nur mit erheblichen Veränderungen erscheinen. Wer als Autor nicht aufpasst, wird verboten. Die Literaturfreiheit ist hierzulande in den letzten Jahren ein großes Stück kleiner geworden.
2007 hat das Bundesverfassungsgericht den Roman Esra von Maxim Biller endgültig verboten. Dabei handelte es sich nicht um einen Akt staatlicher Zensur, sondern um eine Abwägungs-Entscheidung zwischen zwei Grundrechten, nämlich dem Recht auf Kunstfreiheit (Artikel 5, Absatz 3, Satz 1 des Grundgesetzes: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“) einerseits und andererseits dem Schutz der Persönlichkeit, der sich ebenfalls aus dem Grundgesetz ableitet, nämlich aus Artikel 1, Absatz 1, der die Würde der Persönlichkeit für unantastbar erklärt, in Verbindung mit Artikel 2, Absatz 1, der jedem das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zuspricht.
Das Esra-Urteil war bereitsunter den Verfassungsrichtern umstritten, drei Richter wandten sich in Sondervoten gegen die Entscheidung ihrer fünf Kollegen. Bei näherer Betrachtung erweist sich das Urteil als in sich widersprüchlich und lässt erstaunliche Argumentationsbrüche erkennen. Ich habe mich bemüht, die Probleme des Urteils in dem Essay Der Fall Esra. Ein Roman vor Gericht. Über die neuen Grenzen der Literaturfreiheit (Verlag Kiwi eBook extra, 16,99 Euro oder als Print on Demand) detailliert herauszuarbeiten.

Wie auch immer man zum Konflikt zwischen Literaturfreiheit und Persönlichkeitsschutz steht, der im Fall Esra höchstrichterlich verhandelt wurde – das Urteil der Verfassungsrichter eignet sich nicht dazu, auf einem so diffizilen Gebiet klare Verhältnisse und damit Rechtssicherheit zu schaffen. Dennoch ist es derzeit eine feste juristische Orientierungsgröße für alle entsprechenden Gerichtsverfahren und wird das auf heute unabsehbare Zeit bleiben. Erst wenn künftig ein ähnlich gelagerter Fall vor dem Verfassungsgericht verhandelt wird, können die dann zuständigen Richter andere juristische Akzente setzen.
Inzwischen zeigt sich, dass de Entscheidung im Fall Esra starke und unvorhergesehene Auswirkungen zuungunsten der Literaturfreiheit entwickelt. Allein 2011 mussten drei Romane vom Buchmarkt zurückgezogen werden, weil sie angeblich Persönlichkeitsrechte verletzten und mit juristischen Schritten gegen sie gedroht wurde: nämlich die Romane Das Da-Da-Da-Sein von Maik Brüggemeyer (Aufbau Verlag, Berlin 2011), Last Exit Volksdorf von Tina Uebel (Verlag C.H.Beck, München 2011 und Ein Traum von einem Schiff von Christoph Maria Herbst (Scherz Verlag, Frankfurt/Main 2010. Obwohl das Buch bereits im Dezember 2010 erschien, datiert die einstweilige Verfügung gegen den Roman vom 2. Februar 2011; siehe http://www.boersenblatt.net/412846/.)
Zugegeben, die drei Bücher sind von sehr unterschiedlicher künstlerischer Qualität, aber die Häufung der Fälle belegt, in welchem Maße die Bereitschaft von Privatpersonen zugenommen hat, gegen literarische Werke vorzugehen. „Als Schriftsteller, der über die Gegenwart schreibt, kommt man in Deutschland ohne Anwalt nicht mehr aus“, konstatiert Maik Brüggemeyer.


Doch abgesehen von dem Fall Christoph Maria Herbst wurden die Vorwürfe gegen diese Romane gerichtlich nie überprüft. Allein schon die Ankündigung von Unterlassungserklärungen oder einstweiligen Verfügungen gegen die Bücher reichten aus, Verlage und Autoren dazu zu bewegen, die Romane zurückzuziehen und weitgehend so zu verändern, wie es den Wünschen der möglichen Kläger entspricht. Doch darüber, ob die Romane tatsächlich Persönlichkeitsrechte verletzen, hat in diesen Fällen nie ein Richter oder ein unabhängiges Gericht entschieden.
Ein Grund dafür ist nicht zuletzt das Esra-Urteil. Seine inneren Unstimmigkeiten machen die entsprechenden Prozesse zu einem schwer kalkulierbaren Kosten-Risiko. Also verzichten die Verlage lieber auf einen Rechtsstreit und drängen die Autoren, ihre Bücher zu entschärfen. Die Autoren aber haben erst Recht kein Geld für Prozesse, zudem gehört zum üblichen Verlagsvertrag eine Klausel, in der jeder Autor versichert, mit seinem Buch keine Rechte Dritter zu verletzten. Im Falle einer Niederlage vor Gericht würde der Autor also vertragsbrüchig und sein Verlag hätte die Möglichkeit, ihn für die Prozesskosten verantwortlich zu machen. Was diese Entwicklung für eine Literatur in Deutschland bedeuten, die dezidiert gegenwärtige Themen und Typen zu ihrem Thema macht, liegt auf der Hand. Wenn schon die Drohung mit einer Klage ausreicht, um Autoren und Verlage einzuschüchtern, bleibt von der Freiheit der Literatur nicht viel übrig.
Überhaupt: die Kosten. In den hochgemuten Debatten um Literaturfreiheit einerseits und Persönlichkeitsschutz andererseits wird dieser elementare Punkt viel zu oft übergangen: Verlage haben nur seltenen die finanziellen Mittel, einen Rechtsstreit über den ganzen windungsreichen Instanzenweg hinweg durchzufechten. Selbst für große Verlage ist ein solcher Prozess, schon weil er in erheblichem Maße Arbeitskraft bindet, eine beträchtliche Belastung. Mit großer Sicherheit aber ist der Schriftsteller, dem durch die gegenwärtig üblichen Verlagsverträge die juristische Hauptverantwortung zufällt, das wirtschaftlich schwächste Glied in der Kette. Kein Wunder also, wenn die Bereitschaft unter Autoren wächst, im Zweifelsfall sorgsam erwogene ästhetische Intentionen zurückzustellen und ein Buch umgehend zu entschärfen, sobald es angegriffen wird.
Die Furcht vor Prozessen verändert die Literatur
So gewinnt die Furcht vor Rechtsstreitigkeiten immer mehr Einfluss auf die deutsche Gegenwartsliteratur. Um die mitunter nur heimlich wirksamen Mechanismen dieser Einflussnahme etwas deutlicher zu machen, möchte ich hier ein Beispiel etwas ausführlicher darstellen: Im Mai 2011 publizierte der in München lebende Schriftsteller Albert Ostermaier den autobiografischen Roman Schwarze Sonne scheine (Suhrkamp Verlag, Berlin 2011). Er berichtet darin von einem angehenden Schriftsteller, der ihm selbst in vielen Punkten zum Verwechseln ähnlich ist und einem Mönch, der auffällige Ähnlichkeiten mit Notker Wolf, dem höchsten Repräsentanten des Benediktinerordens zeigt.
Anfang der neunziger Jahre hat der junge Romanheld erste Gedichte geschrieben und träumt von literarischem Ruhm. Doch nach einer überstandenen Krankheit drängt ihn sein väterlicher Freund, der zugleich Abt des nahe gelegenen Benediktinerklosters ist, zu einer gründlichen Nachuntersuchung. Der Geistliche verfügt über beste medizinische Kontakte und empfiehlt eine geniale Ärztin, eine Virologin am Max-Planck-Institut: „Diese Frau ist ein Geschenk des Himmels“. Ihr vertraut sich der Nachwuchsdichter tatsächlich an, und das Ergebnis der Untersuchung ist niederschmetternd: Ein heimtückisches Virus hat ihn befallen, er wird in spätestens sechs Monaten tot sein, wenn er nicht sofort mit der Virologin zu einer Spezialtherapie nach USA aufbricht. Möglicherweise ist eine Lebertransplantation nötig.
Die Hiobsbotschaft versetzt den jungen Autor verständlicherweise in Panik, dennoch besteht er auf einer Kontrolluntersuchung durch einen weiteren Mediziner. Doch die braucht Zeit, wochenlang schwebt die Diagnose wie ein Todesurteil über dem Dichter. Schließlich stellt sich zweierlei heraus: Der junge Mann ist kerngesund und die angebliche Virologin gar keine Ärztin, sondern eine Möchtegern-Medizinerin, die ihr Studium nach dem sechsten Semester abgebrochen hat. In ein ungünstiges Licht gerät damit allerdings auch jener väterliche Freund, der die vermeintliche Ärztin und Virologin empfahl – zumal er ihr bereits etliche Klosterbrüder als Patienten zuführte und nach ihrer Entlarvung nicht juristisch gegen sie vorgeht.

So weit der Roman. In ihm hat Ostermaier diesem Geistlichen den Namen Silvester gegeben. Doch in einem Kapitel beschreibt er ihn näher, vor allem seine Neigung zu öffentlichkeitswirksamen Auftritten: Er werde, heißt es, „der rockende Abt“ genannt, da er gelegentlich in Mönchskutte mit einer Hard-Rock-Gruppe auftritt und auf der Querflöte Songs wie „Lokomotive Breath“ von Jethro Tull spielt. Der Hinweis ist deutlich: Notker Wolfs Auftritte als „rockender Abt“ mit der Gruppe Feedback sind von Kirchentagen und aus Talkshows bekannt. Sein Querflöten-Solo zu Locomotive Breath ist auf YouTube abrufbar. (http://www.youtube.com/watch?v=QZlmIJxMTIA) Zudem gibt es Verbindungen zwischen Ostermaier und Wolf. Wer ihre Namen gemeinsam in Internet-Suchmaschinen überprüft, stellt fest, dass beide Absolventen derselben Schule sind: des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums im oberbayerischen St. Ottilien, das lange vom dortigen Benediktinerkloster getragen wurde.
Im Fall des verbotenen Romans Esra war es ähnlich: Autor Maxim Biller hatte über seine Heldin im Buch geschrieben, sie habe als junge Türkin einen Filmpreis erhalten. Mit diesen Angaben war über das Internet ihre Identität problemlos zu ermitteln. Dass Leser kaum je auf die Idee kommen, denkbaren Vorbildern für Romanfiguren per Suchmaschine auf die Spur zu kommen, konnte die Verfassungsrichter bei ihrer Entscheidung nicht beirren. Ihrer Ansicht nach reicht es bereits aus, wenn nur der engste Bekanntenkreis der Betroffenen sie im Roman wiederzuerkennen vermag.
Nach diesen Kriterien kann an der Identifizierbarkeit Notker Wolfs in Ostermaiers Roman wenig Zweifel bestehen. Dennoch blieb das Buch juristisch unbehelligt. Denn für ein Verbot müssten zwei Bedingungen erfüllt sein: Eine reale Figur wird erkennbar geschildert, und sie wird durch die Darstellung im Buch in ihren Persönlichkeitsrechten schwerwiegend verletzt. Doch Ostermaier hält sich im Roman bei allen Spekulationen darüber, welche Art von Verbindungen zwischen der Scheinmedizinerin und dem musizierenden Gottesmann bestehen könnte, auffällig zurück. Sein jugendlicher Held setzt hinter jede Vermutung über die Rolle des Geistlichen bei dem obskuren Zwischenfall immer wieder Fragezeichen. Die Motive des Klostervorstands bleiben damit in der Schwebe.
Mehr noch, Ostermaier schreibt über den Abt sogar ausdrücklich: „Hundertprozentig hatte er keine Pläne entworfen und dann den Gewinn geteilt oder abgerechnet, so war er nicht.“ Und die Überlegung, die Hochstaplerin und der Klosterchef hätten sich vielleicht als Herren über Leben und Tod der angeblich sterbenskranken Patienten gefühlt, gibt Ostermaier als Entwurf zu einem Thriller-Drehbuch aus, der seinem jungen Romanhelden durch den Kopf schießt. Also als eine Fiktion innerhalb der Fiktion des Romans. Das macht das Buch juristisch schwer angreifbar.
Anwälte entscheiden darüber, in welcher Form Romane erscheinen
Offenbar hat sich Ostermaier bei der Arbeit an seinem Roman rechtlich eingehend beraten lassen. Nach dem Esra-Urteil wurde gelegentlich die Befürchtung geäußert, künftig würden in den Verlagen nicht mehr nur die Lektoren, sondern in hohem Maße auch die Anwälte über die Form entscheiden, in der Romane erscheinen. Ostermaiers Schwarze Sonne scheine könnte dafür ein guter Beleg sein. Zeigt sich hier der Anfang einer juristisch zur Konfliktscheu gezwungenen Literatur, für die Romane zu einer nach rechtlichen Vorgaben beliebig formbaren Verfügungsmasse werden?
Parallel zu den Verfahren im Fall Esra wurde von Kritikern nicht selten behauptet, es sei für die Schriftsteller doch ein leichtes, ihre Figuren so zu verfremden, dass niemand sich in ihnen wiedererkennen und also auch niemand in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt fühlen könne. Das mag sein, ob das aber in jedem Fall der literarischen Qualität der Bücher zuträglich ist, darf man bezweifeln. Es gibt mitunter sehr gute Gründe für einen Autor sich in seiner Literatur möglichst eng an das zu halten, was üblicherweise die Realität genannt wird.
Zum Beispiel Büchner
Nehmen wir zum Beispiel Georg Büchners Jahrhundertdrama Dantons Tod. Er hat darin nicht nur reale Personen unter ihren realen Namen geschildert, sondern ihnen auch über weite Strecken ihre real gesprochenen historischen Worte in den Mund gelegt. An ihrer Wiedererkennbarkeit kann juristisch kein Zweifel sein. Als Büchner sein Stück 1835 veröffentlichte, lebte Dantons Frau Louise Gély noch. Im Stück nennt Büchner sie Julie, lässt sie mit ihrem Mann in inniger ehelicher Vertrautheit ins Bett gehen und am Ende auf offener Bühne Selbstmord verüben. Beide Szenen wären nach heute geltender Rechtsprechung problematisch, Büchners Stück würde mit großer Sicherheit verboten. Auch das juristische Argument, Danton und Robespierre seien Personen der Zeitgeschichte bzw. Personen des öffentlichen Lebens, die ein öffentliches Interesse an Informationen aus ihrer Privatsphäre hinnehmen müssten, könnte das Drama vor dem Verbot nicht retten. Denn Dantons Frau stand nicht im öffentlichen Leben, hatte keine historische Funktion während der Französischen Revolution und war mithin keine Person der Zeitgeschichte. Zudem verletzen die beiden genannten Szenen nicht nur ihre Privat-, sondern ihre absolut geschützte Intimsphäre.
Dennoch war es aus ästhetischer Sicht richtig, dass Büchner wiedererkennbare reale Personen beschrieb. Es ging Büchner in Dantons Tod nicht um eine hypothetische Revolution, nicht darum, ein dramatisches Gedankenexperiment namens Revolution an imaginärem Ort, zu fiktiver Zeit mit erdachtem Personal durchzuspielen. Vielmehr zielte er auf literarische und intellektuelle Unmittelbarkeit, auf eine durch historische Tatsachen beglaubigte Dringlichkeit seines Stücks. Er wollte ein entscheidendes Kapitel europäischer Geschichte, den Beginn der politischen Moderne, in seinem geschichtlich verbürgten Verlauf aus der Perspektive eines desillusionierten Nachgeborenen darstellen. Kurz, er wollte aus Leben Literatur machen.



Büchners geniales Stück zeigt exemplarisch, dass es nicht notwendig Skandalgier, Leichtfertigkeit oder künstlerischem Unvermögen sind, die einen Schriftsteller dazu bringen, auf reale Personen als erkennbare Vorbilder für seine fiktiven Figuren zurückzugreifen, sondern dass es für solche ästhetischen Entscheidungen die besten, die überzeugendsten Gründe geben kann – Gründe, die einem Zeitgenossen des Autors vielleicht nicht sofort einsichtig sind. Die Glaubwürdigkeit von Dantons Tod, seine quälende historische Überzeugungskraft wäre geringer, hätte Büchner nicht auf geschichtlich verbürgte Fakten und Personen zurückgegriffen, hätte er nicht versucht, aus dem Leben Literatur zu machen. Auch wenn das auf Kosten der Persönlichkeitsrechte von Dantons Frau Louise Gély ging.
Vergleichbaren Ambitionen hat das Verfassungsgericht mit seinem Esra-Urteil ein erhebliches und in seiner Wirkung schwer kalkulierbares Hindernis in den Weg gestellt. Schriftsteller, die mit Büchnerscher Dringlichkeit und Direktheit ihre Gegenwart oder jüngere Vergangenheit zur Sprache bringen wollen, müssen heute in Deutschland mit beträchtlichen juristischen Widerständen rechnen.
Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, die Persönlichkeitsrechte seien heute in besonders großer Gefahr und müssten deshalb besonders nachdrücklich verteidigt werden. Das ist sicher richtig, aber die großen Gefahren für die Persönlichkeitsrechte gehen heute doch wohl von manchen Formen des Boulevard-Journalismus und von der enormem Macht sozialer Netzwerken wie Facebook aus, nicht aber von der Literatur.
Im Gegenteil, die Literatur braucht Verteidiger. Immer mehr Leser (auch Leser in Richterroben) scheinen in der Literatur nur noch einen zu Text geronnenen Abklatsch dessen sehen zu wollen, was der jeweilige Autor erlebt hat – und übersehen damit die eigentlich literarische, das Erlebnismaterial künstlerisch formende Arbeit des Autors. Es ist bis heute nicht einzusehen, weshalb nur so wenige Literaturkritiker, Verleger und Schriftsteller bereit waren, sich während der langen Esra-Prozesse öffentlich für die Interessen der Literatur einzusetzen und das Romanverbot als das zu bezeichnen, was es ist: ein Skandal.
Doch jetzt ist das Kind im Brunnen – und dort wird es bleiben, falls sich Verleger, Autoren, Kritiker, nicht dazu entschließen, künftig energischer für die Rechte der Literatur zu streiten. Ohne Konflikte wird der ehemals vorhandene literarische Spielraum nicht zurückzuerobern sein. Solange Bücher aber schon bei der Androhung juristischer Konflikte zurückgezogen und entschärft werden, ist hier keine Änderung in Aussicht.
 Friederike Brion geboren. Jahrzehnte- wenn nicht jahrhundertelang haben sich Germanisten darüber gestritten, ob die beiden tatsächlich miteinander schliefen oder nicht. Ob die Germanisten das etwas anging, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall haben beiden sehr für einander geschwärmt – und Friederike blieb bis zu ihrem Tod 1813 unverheiratet.
Friederike Brion geboren. Jahrzehnte- wenn nicht jahrhundertelang haben sich Germanisten darüber gestritten, ob die beiden tatsächlich miteinander schliefen oder nicht. Ob die Germanisten das etwas anging, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall haben beiden sehr für einander geschwärmt – und Friederike blieb bis zu ihrem Tod 1813 unverheiratet.