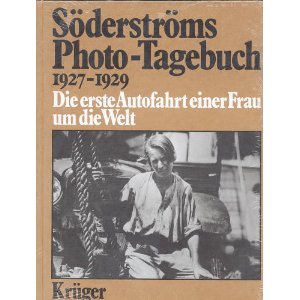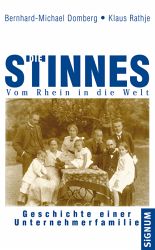„Was? Das gefällt ihnen? Sie Banause!“
Wir leben in einer Gesellschaft der Abgrenzung mit ästhetischen Mitteln. Dabei zählte es doch einmal zu den vornehmsten Aufgaben der Kunst, Menschen einander näher zu bringen. Was läuft da schief? Und, kann sich das wieder ändern? Mit anderen Worten: Wir stehen vor der Frage, warum sich Thomas, Manfred und Silke nichts mehr zu sagen haben. – Ein kleiner Essay über die Rolle der Kunst in der desintegierten Gesellschaft
Vielleicht war es früher einmal ein Privileg, Geschmack zu haben. Heute ist es das nicht mehr, im Gegenteil: Heute hat jedermann Geschmack. Zumindest würde jeder, den man nach seinen ästhetischen Entscheidungen befragte, so glaubhaft wie Frank Sinatra versichern können: „I did it my way“.

Wie sang es schon der große Philosoph Sinatra? "I did it my way"
In vergangenen Jahrhunderten war es schwer genug das tägliche Überleben zu sichern; nur wenige Menschen hatten die Zeit, sich mit Stilfragen herumzuschlagen. In den Industriestaaten westlicher Prägung ist das gründlich anders geworden. Hier sind alle, deren Einkommen über dem Existenzminimum liegt, unentwegt in ihrem ästhetischen Urteilsvermögen herausgefordert: Sie müssen aus dem endlosen Angebot einer Überflussgesellschaft auswählen, was zu ihnen passt und was nicht. Geschmack zu haben, ist damit zu einem endemischen Phänomen geworden. Ob das dem Geschmack gut getan hat, sei dahingestellt.
Drei Beispiele: Thomas, 37, Manfred, 44 und Silke, 25
Betrachten wir drei Beispiele: Thomas, 37, darf sich als Profi der Urteilskraft betrachten. Er ist Redakteur einer Tageszeitung und schreibt im Kulturteil diese langen Artikel, in denen schwungvoll unterschieden wird zwischen dem, was ästhetisch „noch möglich ist“, und dem, was „nicht mehr geht“. In diesen Fragen weiß Thomas hundertprozentig Bescheid – und Kunstwerke, die nicht exakt den seiner Meinung gerade gültigen ästhetischen Positionen entsprechen, sind für ihn sofort Kitsch und ihre Urheber Banausen.
Manfred, 44, ist Elektrotechniker und ein ausgeglichener Mensch, der Gemütlichkeit über alles schätzt. Lediglich beim Autofahren versteht er keinen Spaß: Schon als Auszubildender hat er sich einen BMW gekauft, und dieser Marke bleibt er treu, soviel steht fest. Er könnte, bäte man ihn darum, die aktuelle Modellpalette samt PS-Zahlen, Hubraum-Angaben und Höchstgeschwindigkeiten aus dem Kopf runterleiern. Als Mercedes kürzlich den neuen GLK Kompakt-SUV vorstellte, fühlte er sich ein paar Monate lang ganz hilflos. Doch jetzt bringen die Münchner das überarbeitete SUV-Coupe X6 und mit dem hat Manfred, das spürt er, als eingefleischter BMW-Fahrer die Nase wieder vorn.
Silke, 25, arbeitet seit dem Abitur als Sekretärin und hat Chancen, Chefsekretärin zu werden. Abends geht sie gern aus, sie kennt alle „In-Locations“ der Stadt, wo man „abtanzen“ kann. Derlei Kenntnisse sind, nebenbei bemerkt, schwerer zu erwerben als solche über Büroorganisation, denn das Nachtleben ist geprägt durch ein beängstigendes Veränderungstempo. Wo sich vor einem halben Jahr noch die – nach Silkes Ansicht – richtigen Leute in der richtigen Kleidung bei der richtigen Musik trafen, ist man inzwischen hoffnungslos out. Silke kann da nur am Ball bleiben durch eine gut trainierte Beobachtungsgabe und die einschlägige Fachliteratur: Diverse Mode-, Lifestyle- und Stadtmagazine schärfen ihren Blick für subtile Details, die ihr signalisieren, ob ein Lokal in ihrem spezifischen Sinne akzeptabel ist.
Alle drei sehen sich tagaus tagein mit Geschmacksfragen konfrontiert, alle drei haben die Freiheit und die Möglichkeiten, diese Fragen nach ihren persönlichen Wünschen zu entscheiden. Kein Wunder also, wenn sie zu höchst unterschiedlichen Gewichtungen und Vorlieben kommen. Brächte man sie dazu, am selben Tisch Platz zu nehmen, fänden sie vermutlich kaum ein gemeinsames Gesprächsthema.
Betrachtet man die drei jedoch aus größerer Distanz, werden sie sich überraschend ähnlich: Sie haben eine solide Ausbildung, sind fest angestellt und arbeiten im ewig gleichen Rhythmus acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Falls Silke in ein paar Jahren den Sprung zur Chefsekretärin schafft, gehören die drei noch dazu ähnlichen Gehaltsstufen an, ja es ist durchaus vorstellbar, dass alle – leise murrend – die selbe Partei wählen. Mit einem Wort: Sie sind Durchschnittsbürger eines gewöhnlichen westeuropäischen Wohlstandsstaates.
Unser Geschmack verteidigt unseren sozialen Status
Um so wichtiger werden für sie jene geschmacklichen Differenzen, durch die sie sich von anderen absetzen. Gerade in einer weitgehend egalitären, demokratischen Gesellschaft, in der die alten sozialen Gräben zwischen Herren und Knechten – oder marxistisch gesprochen: zwischen den Klassen – zu einem großen Teil eingeebnet worden sind, übernehmen die ästhetischen Gegensätze die Rolle eines wesentlichen, eifrig gehüteten Unterscheidungsmerkmals. Heute ist es, wie Pierre Bourdieu betonte, der „Geschmack“, der „klassifiziert – nicht zuletzt den, der die Klassifikationen vornimmt. Die sozialen Subjekte [...] unterscheiden sich voneinander durch die Unterschiede, die sie zwischen schön und hässlich, fein und vulgär machen und in denen sich ihre Position in den objektiven Klassifizierungen ausdrückt oder verrät.“

Pierre Bourdieu Studie "Die feinen Unterschiede" über die Folgen des Geschmacks für den sozialen Status
Diese neue Abhängigkeit von kleinen und allerkleinsten Geschmacksdifferenzen erklärt, weshalb heutzutage viele ihre ästhetischen Standpunkte so barsch von allen andern abgrenzen: Sie glauben unter der Hand ihren sozialen Status zu verteidigen. Manfred lässt schon deshalb an Mercedes kein gutes Haar, um sich in seinem BMW als König des Straßenverkehrs zu fühlen. Je exklusiver und abstrakter die Kunsttheorien sind, in denen Thomas schwelgt, desto größer ist seine Distanz vom gewöhnlichen Publikum – und natürlich interpretiert Thomas diese Distanz ein untrügliches Zeichen von Überlegenheit. Und Silke, die nach wie vor „House“ für den Hort zeitgemäßer Pop-Kultur hält, kann in den Anhängern von „Dance-Floor“ nur „komplett uncoole Lackaffen“ sehen.
Selbstverständlich stehen die drei mit ihrem jeweiligen Faible nicht allein. Sie rechnen sich vielmehr einem bestimmten Milieu zu, oder, wie Silke sagen würde, einer „Szene“, in der man gleiche Vorlieben pflegt. Eine moderne Wahlverwandtschaft, die für den einzelnen offenkundig immer wichtiger wird. Der Soziologe Gerhard Schulze nannte Deutschland deshalb kurzerhand eine „Erlebnisgesellschaft“: Da die ökonomischen Überlebensprobleme für den größten Teil der Bevölkerung gelöst sind, können heute die alltäglichen Entscheidungen ohne Rücksicht auf die Existenzsicherung ganz nach Neigung und Geschmack getroffen werden. Angesichts der unüberschaubaren Angebotsvielfalt müssen die Menschen deshalb lernen, sich auf ihr psychisches Erleben als Richtschnur für ihre Entschlüsse zu konzentrieren. Weshalb zum Beispiel ein Verkäufer heute, um Kunden zu gewinnen, nicht die Haltbarkeit oder Zweckmäßigkeit seines Produkts herausstreicht, sondern viel lieber dessen „Erlebnisqualität“.
Mein Milieu ist meine Heimat
Damit heißt es allerdings, so stellte Schulze fest, vom herkömmlichen Bild unserer Gesellschaft Abschied zu nehmen: Für die Entstehung von Klassen oder Schichten ist nicht mehr die Position der Bürger im Produktionsprozess, ihre Ausbildung oder die Höhe ihres Einkommens entscheidend. Statt dessen bilden sich die sozialen Gruppen eher durch den bevorzugten Erlebnistyp, der die Beteiligten nicht nur mit schier unerschöpflichem Diskussionsstoff versorgt, sondern ihnen auch so etwas wie eine Wertordnung an die Hand gibt.

Gerhard Schulze "Die Erlebnisgesellschaft" - oder die Frage, weshalb jedes Milieu seine eigene Wertordnung hat
So beschreibt Schulze unter anderem ein „Niveaumilieu“, das aus dem traditionellen Bildungsbürgertum hervorging und in dem man kulturellen Erfahrungen zentrale Bedeutung zuordnet (ihm gehört zweifellos Thomas, der stramm urteilende Kulturredakteur, an). Das „Harmoniemilieu“ dagegen, das sich aus den alten Arbeiterschichten entwickelte, sucht vor allem das Gefühl der Geborgenheit (hier wäre wohl Manfred einzuordnen, solange er nicht hinterm Steuer sitzt). Zu den neueren Phänomenen zählt das „Unterhaltungsmilieu“, das auf Zerstreuung aus ist (und dem wir Silke zurechnen dürfen – falls wir sie nicht dem „Selbstverwirklichungsmilieu“ zuschlagen, dem es von der Psychotherapie bis zum buddhistischen Retreat um die Entfaltung der Persönlichkeit geht).
Natürlich sind die Grenzen zwischen diesen Kategorien fließend und nicht unüberwindlich. Doch hält das die Beteiligten keineswegs davon ab, der Zugehörigkeit zu ihrem Milieu enorme Bedeutung zuzumessen. Denn dieses Milieu bietet ihnen in einer anonymen und immer komplexer werdenden Gegenwart hervorragende Identifikationsmuster an: Aus der beängstigenden Angebotsvielfalt der Gesellschaft filtern sich, ist Auswahl einer „passenden“ Gruppe erst einmal getroffen, für den einzelnen klare, von allen Gleichgesinnten anerkannte Hierarchien und Handlungsschemata heraus, an denen er sich orientieren kann. Was, nebenbei bemerkt, keineswegs den bewusst vollzogenen Eintritt in irgendeinen Club oder Clan voraussetzt – vermutlich ist das Gefühl der Zugehörigkeit sogar noch wirksamer und unerschütterlicher, je unbemerkter es subjektiv bleibt.
Vom Zwang zu ästhetisch korrekten Urteilen
Die Kehrseite der Medaille ist ein hoher Konformitätsdruck: Ein BMW-Fan hat nach dem Kauf eines Opels mit ernsten Sanktionen durch seine alten Mitfans zu rechnen – im Ernstfall muss er sich neue Freunde suchen. Oder um ein Beispiel aus einem anspruchsvolleren Milieu zu wählen: Wer die ästhetischen Wertungen, die Thomas so gewohnt ist, in Frage stellt, der darf von ihm kein Interesse erwarten, sondern muss auf Unverständnis, wenn nicht auf Aggression gefasst sein. Denn für Thomas geht es bei solchen Debatten nicht nur darum, Kunstwerke in einem anderen, möglicherweise lehrreichen Licht zu betrachten. Es geht ihm dabei im Stillen immer auch um die Unantastbarkeit seiner – milieugestützten – Identität und um seinen sozialen Status. Neben dem Zwang zu politisch korrekten Ansichten entsteht so auch einer zu ästhetisch korrekten Urteilen.
Das Auseinanderdriften der Gesellschaft in verschiedene Milieus mit verschiedenen geschmacklichen Vorlieben bringt – ironischerweise – gerade die Künstler und Schriftsteller, die doch die Geschmacksbildner sein sollten, mehr und mehr in Verlegenheit. Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts gab es eine allgemein gültige ästhetische Rangordnung: Gewiss, nicht alle Schichten hatten die Chance, am kulturellen Leben teilzunehmen und natürlich wurden die etablierten Ruhmesträger der Kunst und der Literatur von der jeweils nachdrängenden Generationen bekämpft. Aber selbst solche Ausgrenzungen und Rangkämpfe haben die Autorität jener ästhetischen Hierarchie letztlich nur bestätigt.
Heute macht sich jedes Milieu seine eigene Hierarchie zurecht. Verbindliche ästhetische Bezugs-, oder auch nur gemeinsame Streitpunkte zwischen den unterschiedlichen sozialen Gruppen werden immer seltener. Ein Prozess, der sich besonders gut in den USA studieren lässt, der aber auch in Deutschland zu beobachten ist: Obwohl die Bürger juristisch rundum gleichgestellt sind, zerfällt die Gesellschaft zunehmend in die beschriebenen erlebnisorientierten Milieus oder in kompakte Interessengruppen, die nur noch um sich selbst, ihre eigenen Belange und Wertungen kreisen: von der Frauenbewegung bis zur Tea Party, von der Schwulenkultur bis zur „moral majority“, von religiösen Gemeinschaften bis zu ethnischen Minderheiten.
Ökonomisch hat diese wachsende soziale Desintegration bislang wenig Probleme gemacht. Im Gegenteil: Sie kommt dem notorischen Ziel der Marktwirtschaft, immer neue, immer andere Wünsche zu wecken und zu befriedigen, entgegen. Aus der Perspektive eines Marketing Managers ist die Aufspaltung der Gesellschaft zunächst einmal hilfreich: Durch sie werden die verschiedenen Zielgruppen samt ihres spezifischen Bedarfs für ihn präziser eingrenzbar.
Romane von Glatzköpfen für Glatzköpfe
Schriftsteller oder Künstler dagegen geraten in die Gefahr, mit ihrer Arbeit nur noch in kleinen und immer kleineren Kreisen verständlich zu sein. Was in dem einen Milieu Furore macht, ist im nächsten schon ohne jedes Interesse oder sogar kaum noch begreifbar. „Bald wird es Bücher geben“, warnte die Schriftstellerin Dagmar Leupold bereits in den neunziger Jahren, „die von Frauen geschrieben wurden, die unter PMS (prämenstruellem Syndrom) leiden, und nur von denen gelesen werden, die dasselbe Problem haben. Oder von glatzköpfigen Männern für ebensolche. Zum Schluss schreibt man fürs Spiegelbild.“

Dagmar Leupolds erster Roman "Edmond - Geschichte einer Sehnsucht"
Natürlich kann man sich mit der Resonanz oder dem Erfolg in einem derart eingezäunten Terrain zufrieden geben. Tatsächlich tun das mittlerweile nicht wenige Künstler: Sie zielen mit ihrer Arbeit unübersehbar auf die Erwartungen und Interessen des, wie es Gerhard Schulze mit leisem ironischem Unterton genannt hat, „Niveaumilieus“. Da ihre Werke sinnlich wenig wirkungsvoll und hochgradig chiffriert sind, werden andere Milieus als potentielle Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen – was wiederum dem verbliebenen Publikum ein wohliges Bewusstsein von Besonderheit und Exklusivität verschafft.
Der Haken an der Sache ist, dass Autoren und Künstler damit in eine sozial affirmative Rolle verfallen. Sie beschränken sich – wie clevere Marketing Manager – auf „ihre“ Zielgruppe. Thomas, unser Repräsentant des Niveaumilieus, würde das nicht gern hören, da er sich auf seine kritische Haltung zum Bestehenden einiges zugute hält. Doch gerade durch die anmaßende Rigorosität, mit der er alles als Kitsch verdammt, was seinen Vorstellungen auch nur haarscharf widerspricht, wird er im Sinne Bourdieus zu einem Agenten und Profiteur der herrschenden (kulturellen) Klassengegensätze.
Die Kunst nur für Kunstkenner?
In unserer so hochdifferenzierten Gesellschaft droht etwas Selbstverständliches in Vergessenheit zu geraten: Die Künste dienen keineswegs nur dazu, die Bedürfnisse der Kunstkenner zu befriedigen. Sie zielen auch nicht allein auf Menschen, die sich durch die Themen der jeweiligen Werke betroffen fühlen: Die Vorstellung einer – beispielsweise – speziell auf Homosexuelle, Frauen oder Farbige zugeschnittenen Literatur ist zwar geläufig geworden, sie bleibt aber hinter den wirklichen Möglichkeiten der Literatur weit zurück. Gleiches gilt für die ebenso beliebte wie kleinkarierte Rubrizierung der Kunst in einen „E-“ und einen „U“-Bereich, und den damit verbundenen Aberglauben, ernsthafte Werke würden durch unterhaltsame Elemente Schaden nehmen oder irgendwie entweiht.
Tatsächlich waren und sind große Kunstwerke immer so etwas wie eine Quadratur des Kreises: überraschende, glückhafte Synthesen zwischen Elementen, die vermeintlich unvereinbar sind, zwischen höchsten Ansprüchen und populärer Unterhaltsamkeit, zwischen Innovation und Tradition, Intellektualität und Sinnlichkeit, Abstraktion und Konkretion. Diese besondere Gabe verleiht ihnen die Fähigkeit, nicht nur auf einen kleinen Teil der Menschheit, auf thematisch Betroffene oder einen selbsternannten Bildungsadel zu wirken, sondern tendenziell auf alle – und das mitunter über Jahrhunderte hinweg. Angehörige jeder Generation, Gemeinde oder Gruppierung können sich von ihnen angesprochen fühlen, eben weil es ihnen nicht um Verständigung mit einer Gruppe geht, sondern um Verständigung schlechthin. In diesem Sinne ist Kunst das Gegenteil zu dem grassierenden Kult um die feinen Unterschiede; in diesem Sinne schafft sie gekonnte Verbindungen, nicht faule Kompromisse, zwischen sonst widersprüchlichen Eigenschaften.
Der Glaube an die Möglichkeit von solch wundervollen Synthesen, ja selbst die Sehnsucht nach ihnen geht hierzulande im Irrgarten der Milieus und Minderheiten mehr und mehr verloren. Was niemanden überraschen sollte, da selbst Kritiker (oder Wissenschaftler) wie Thomas, die doch eigentlich das Bewusstsein für jene integrativen Fähigkeiten der Kunst wach halten müssten, schon durch die Diktion ihrer Artikel lieber das zweifellos noch immer vorhandene Bildungsgefälle betonen – obwohl doch Bildung und Geschmack, Bildung und ästhetische Wahrnehmungskraft keineswegs Hand in Hand gehen müssen. Für eine Kunst, die sich auf ihre erstaunliche Kraft zur Synthese besinnt, statt sich in angeblichen Gegensätzen zu verlieren, ist die Desintegration der Gesellschaft keine Existenzbedrohung, sondern kann eine großartige Chance sein.
“Dem Scheitern abgerungen” – und ähnliche Klischees der Kunstkritik
Doch solche Argumente würden Thomas noch nicht überzeugen. Er rechtfertigt seine Vorliebe für wenig zugängliche Kunstwerke auch gern mit dem Hinweis, dass sich diese, gerade weil sie so unzugänglich sind, erfolgreich gegen die Vermarktungsabsichten der Kulturindustrie sperrten. Er übersieht dabei allerdings, in welchem Maße die Kulturindustrie inzwischen dazugelernt hat: Längst hat sie aus dem Widerstand, den ein Werk seiner Vermarktung entgegensetzt, ein exquisites Verkaufsargument zurechtgeschneidert, das sich der entsprechenden kleinen, aber feinen Zielgruppe aus dem „Niveaumilieu“ hauteng anschmiegt.
Selbst die entsprechenden Avantgardetheorien samt ihrem steilen Anti-Kommerzialismus eignen sich mittlerweile vorzüglich für kommerzielle Werbezwecke. Da heißt es etwa in einer Anzeige einer Textilfirma unter dem Bild einer gediegen gekleideten Dame: „Vera Munro ist als Galeristin auf der Suche nach Grenzgängern in der Kunst. Dabei entdeckt sie Unschärfen und Brüche, an denen sich – dem Scheitern abgerungen – Unsagbares zeigt. Mit klarem Blick für Qualität tritt Vera Munro für Positionen ein, auch wenn sie längst nicht als gesichert gelten.“ Solange sich Sätze wie diese fast wortgleich in ernstgemeinten Rezension finden, darf man vermuten, dass es mit der liebevoll gepflegten zeitkritischen Attitüde der jeweiligen Rezensenten nicht so weit her sein kann: Von Werbetextern unterscheiden sie sich oft nur durch ihren schwerfälligen Stil.
Wie eigentümlich und antiquiert sich jene puristische Ästhetik heute ausnimmt, wird mit Blick auf eine Welt deutlich, die über kontinentale Entfernungen und schroffste (Kultur-)Gegensätze hinweg immer enger vernetzt ist. Während hierzulande manche eifersüchtig über angeblich unvereinbare Differenzen wie die zwischen „E-“ und „U“-Literatur, Frauen- und Männer-Kunst, Pop- und ernster Musik wachen, gehen andernorts die talentiertesten Köpfe daran, Synthesen zwischen Weltkulturen zu schaffen – und das ohne Berührungsängste populären Ausdrucksmitteln gegenüber.
Funky Culture
Angesichts eines solchen globalen Bemühens um Integration, Austausch und Verständigung ist die Sehnsucht nach der alten ästhetischen Reinheit ungefähr so segensreich und durchdacht wie die Sehnsucht nach ethnischer Reinheit. Klüger wäre es, den verblüffenden Verbindungen, die da zur Zeit entstehen, unvoreingenommen gegenüberzutreten und sie mit David Byrne, dem Musiker, Filmer und Autor, als „funky culture“ zu betrachten: „Auf gar keinen Fall kann man sie unverdorben nennen. Es ist eine schmutzige Mixtur. Aber Reinheit ist sowieso ein abstrakter Begriff. Sie existierte niemals wirklich. Die großen Städte der Welt, und was sie hervorbrachten, waren das Ergebnis solch gottloser Mischungen.“

David Byrne und Talking Heads: "Essential"
Diese Mixtur birgt Chancen. Darunter vermutlich die beste Chance, nicht nur der fortschreitenden sozialen Desintegration entgegenzuwirken, sondern aus ihr einen Aufbruch zu machen: „Eine Unzahl von ghettoisierten Kulturen,“ stellt sich David Byrne vor, „die im Begriff sind, aufeinander loszugehen. Bilder eines chemischen Experimentes kurz vor der Reaktion. Alle richtigen Elemente sind vorhanden, aber es gibt keinen Vorläufer für die Substanz, die sie bilden werden. Es ist einen neue Ursuppe.“





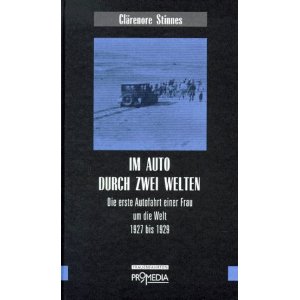

 größten Industrie- und Handelskonzerne Europas geformt, und gehörte, als er 1924 starb, zu den einflussreichsten Männern des Landes. Sorgen ums Geld hatten im Leben seiner Tochter nie eine Rolle gespielt, auch nicht nachdem der Konzern 1925 unter der Führung ihrer Brüder während der Inflation zerfiel. Die Liste der Menschen, die sie im Haus ihrer Familie kennenlernte, liest sich heute wie ein Lexikon der gesellschaftlichen Elite ihrer Zeit.
größten Industrie- und Handelskonzerne Europas geformt, und gehörte, als er 1924 starb, zu den einflussreichsten Männern des Landes. Sorgen ums Geld hatten im Leben seiner Tochter nie eine Rolle gespielt, auch nicht nachdem der Konzern 1925 unter der Führung ihrer Brüder während der Inflation zerfiel. Die Liste der Menschen, die sie im Haus ihrer Familie kennenlernte, liest sich heute wie ein Lexikon der gesellschaftlichen Elite ihrer Zeit.