Martin Mosebach vs. Andreas Platthaus
Das Buch „funktioniert“ nicht – schreibt Andreas Platthaus heute in der FAZ. Martin Mosebachs Gesellschaftsroman Das Blutbuchenfest spiele im Jahr 1991, die handelnden Figuren benutzten aber Technik, die es damals noch nicht gab: Smart-Phones, Laptops, das Internet, Emails. Es werde interessant sein zu beobachten, „ob sich Mosebachs Publikum über seine Erzählverschluderung erregt“, meint Platthaus. Noch ist der Roman offiziell gar nicht erschienen, schon wird er in die Tonne getreten. Oder übertreibt Platthaus doch ein wenig?
Zunächst einmal, damit keine Missverständnisse entstehen: Andreas Platthaus ist ein sympathischer Kollege, den ich nicht zuletzt für seine immensen Kenntnisse zur Kunst des Comics, des Cartoons und der Graphic Novel bewundere. Aber gerade weil ich ihn schätze und als differenzierten Kritiker kenne, verblüfft es mich, wenn er es sich in diesem Fall so einfach macht.
Bekanntlich ist Maria Stuart, Königin von Schottland, ihrer Gegenspielerin Elizabeth I. nie begegnet. In Schillers Drama Maria Stuart gewährt ihr der Autor nicht nur ein Treffen, sondern einen langen, hinreißenden Dialog mit Elizabeth. Das widerspricht den historischen Fakten eklatant. Aber „funktioniert“ Schillers Stück deshalb nicht?
Im Gegensatz zur Geschichtsschreibung lässt sich die Literatur nicht auf die Treue zu den Tatsachen festlegen. Wer die Zeit um 1991 mit den Augen des Zeithistorikers oder des Soziologen betrachtet, hat sich sklavisch an die historischen Fakten halten. Doch wer einen Roman über diese Zeit schreibt, muss die Wahrheit seiner Geschichte erfinden – und wenn er zugunsten dieser erfundene Wahrheit ein paar historische Tatsachen so zurechtrückt, wie er es für die innere Logik seines Romans braucht, dann ist das nicht nur sein gutes literarisches Recht, sondern seine literarische Pflicht.
Mosebachs Blutbuchenfest zeigt eine gerade in ökonomischer Hinsicht konsequent modernisierte Stadtgesellschaft: Die meisten Figuren gehen sehr abstrakt gewordenen, etwas halbseidenen Tätigkeiten nach. Sie leiten eine PR-Agentur, die Kontakte schafft und für derlei luftige Leistungen gut bezahlt wird. Oder sie sind Kuratoren ohne Aufträge, die Kongresse oder Ausstellungen organisieren, für die sich später – vielleicht – die nötigen finanziellen Mittel finden werden. Oder sie haben ihren Job in der Werbung längst verloren und lassen deshalb jetzt für ihren aufwendigen Lebensstil nicht mehr das Spesenkonto, sondern einen gutmütigen Restaurantwirt einstehen.
Ich finde diese Beschreibung der gesellschaftlichen Situation überzeugend und zutreffend. Als langjähriger Bürger Frankfurts bestätige ich gern, wie schön Mosebach manche seiner Schauplätze nach der Frankfurter Wirklichkeit modelliert hat und wie viele seiner Figuren realen Personen dieser Stadt wie aus dem Gesicht geschnitten sind.
Die immer schwerer greifbaren, sich verflüssigenden beruflichen Verhältnisse, die Mosebach schildert und die bereits die neunziger Jahre prägten, sind naturgemäß nicht das einzige Kennzeichen dieses sich radikalisierenden Modernisierungs-Prozesses. Parallel dazu erleben wir eine Revolution der Computer- und Kommunikationstechnik. Die traditionelle Ordnung der Berufstätigkeit löst sich damit immer weiter auf: Mit einem Smart-Phone haben heute viele ihre Produktionsmittel buchstäblich in der Tasche. Wer früher für seine Arbeit einen Schreibtisch brauchte, braucht heute nur noch ein Telefon-Display oder ein Laptop. Er ist räumlich ungebunden, immer mobil, auf Präsenz nicht mehr festlegbar und wird so immer unfassbarer.
Das hat natürlich Folgen für das Leben der Menschen – und diese Folgen versucht Mosebach in seinem Roman erkennbar werden zu lassen. Diese zunehmende Schwerelosigkeit unseres Arbeits- und Gesellschaftslebens ist aber keineswegs eine Erfindung der letzten Jahre, sondern war auch schon in den Neuzigern spürbar. Folglich ist es mir als Leser von Mosebachs Roman schnuppe, ob er nun die jüngsten Erfindungen der IT-Branche entgegen den historischen Fakten in diese Neunziger zurückverlegt. Es geht ja darum, einen gesellschaftlichen Prozess mit den Mitteln eines Erzählers so sichtbar wie möglich zu machen. Und dabei hilft der kleine Zeitsprung, der technische Umwälzungen zehn Jahre früher beginnen lässt, ganz unbedingt.
Andreas Platthaus versteht – und da kann ich ihm überhaupt nicht mehr folgen – Mosebachs Roman als eine Abrechnung mit jenen Menschen, die diesem Modernisierungsprozess unterliegen. Er schreibt: „Denn die ständige Erreichbarkeit ist zentral fürs ganze Geschehen; erst sie macht den behaupteten moralischen Skandal einer egozentrischen Gruppe von Wohlstandsbürgern plausibel, in deren Wohnungen jeweils dieselbe bosnische Putzfrau arbeitet, die im Laufe des Buchs alles verlieren wird, ihr Kind, ihre Heimat, ihre Familie und schließlich auch jeden Respekt vor dem Gastland und seinen Menschen.“
Das ist schlicht falsch. Mosebach verurteilt seine Figuren nicht, er beobachtet sie. Er konstruiert aus dem finsteren Schicksal der bosnischen Putzfrau Ivana keinen Vorwurf gegen jene „Wohlstandsbürger“, die ihr Arbeit geben: 1) Ivanas Kind kommt bei einem Unfalls in Bosnien um. 2) Ihre Heimat geht verloren wegen der lang zurückreichenden ethnischen und religiösen Konflikte in Jugoslawien. 3) Ihre Familie wird vertrieben, weil sie schicksalhaft in diese historischen Konflikte hineingeboren wurde, in denen sie Täter und Opfer zugleich ist.
Daraus einen Vorwurf gegen die „egozentrische Gruppe von Wohlstandsbürgern“ zu konstruieren, wie Platthaus das tut, ist absurd. Im Gegenteil: Mosebach zeigt in den Kapiteln seines Romans, die in Bosnien spielen, sowohl den Reiz als auch die Schrecken der vormodernen Lebensverhältnisse dort sehr deutlich. Es feiert mit der ihm eigenen Sprachpracht manche Schönheit, die seinem Helden dort begegnet, beschreibt aber auch die ausweglose Grausamkeit, mit der sich dort Nachbarn seit Jahrhunderten belauern und bekriegen.
Ebenso wird das moderne Großstadtleben einige hundert Kilometer nördlich in Deutschland nicht verdammt – denn schließlich herrscht hier ein wunderbarer Frieden und auch wenn die Menschen allerlei windigen Geschäften nachgehen, so verstehen sie es doch ihre Konflikte allesamt gewaltlos auszutragen. Zugegeben, die bürgerliche Gesellschaft Frankfurts macht in Mosebachs Roman tatsächlich einen recht egozentrischen Eindruck, aber dass die Bosnier von ihm als vorbildliche Altruisten beschrieben werden, kann niemand behaupten. Mosebach schildert halt Menschen und keine Heiligen.
Platthaus schreibt spürbar abfällig von den „Lobpreisern“ Mosebachs, die ihn um jeden Preis gegen Kritik verteidigen wollen. Um auch hier einem Missverständnis vorzubeugen: Ich kann mit Mosebachs Kampf um liturgische Feinheiten der katholischen Messe wenig anfangen. Und wenn Mosebach öffentlich verlangt, Gotteslästerung solle hierzulande juristisch strenger verfolgt und bestraft werden, stehen mir die Haare zu Berge. Kritik an Mosebach ist selbstverständlich möglich und meines Erachtens gelegentlich angebracht.
Aber ich habe es schon immer für einen Fehler gehalten, von den politischen Stellungnahmen eines Schriftstellers auf seine literarischen Werke kurzzuschließen. Der Schriftsteller Günter Grass, der mit Blechtrommel und Hundejahre großartige Romane geschrieben hat, ist ein anderer als der Bürger Günter Grass, der mir mit seinen Ansichten zu USA oder Israel häufig genug auf die Nerven geht.
Hier, glaube ich, ist der Grund für den Unwillen zu finden, mit dem Platthaus auf Mosebachs neuen Roman reagiert: Er liest das Buch und hat die fröhliche Unverfrorenheit im Kopf, mit der sich Mosebach selbst als Reaktionär und Antimodernist bezeichnet. Und glaubt deshalb in dem Roman ziemlich platte reaktionäre und antimoderne Züge zu entdecken.
Aber das ist nicht der Fall: Die spezifische Erzählweise des Gesellschaftsromans bleibt auch für Mosebach nicht ohne Folgen. Sie ist so etwas wie eine literarische Schule der Toleranz, die jede Gesellschaft als Versammlung von Individuen betrachtet, in der keiner der alleinige Inhaber der Wahrheit ist, sondern in der alle mit dem gleichen Recht ihrer persönlichen Wahrheit und Weltsicht folgen. In diesem Nebeneinander der Standpunkte, das sich nie harmonisch auflöst, sondern nur ausgehalten werden kann, haben antimoderne Sichtweisen ebenso ihren Platz wie solche, die sich für die Moderne begeistern.
Und um diese Gegenüberstellung geht es dem Roman: Hier das vormoderne Lebensverständnis von Ivana, der bosnischen Putzfrau, und dort die hypermoderne Lebenssituation der guten Frankfurter Gesellschaft. Und ob die Angehörigen dieser Gesellschaft nun bereits Anfang der Neunziger ein Smart-Phone in der Tasche hatten oder erst zehn Jahre später, ist dabei literarisch herzlich egal.


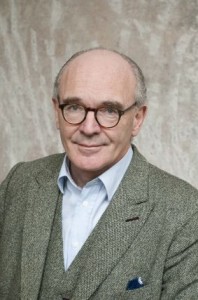
Lieber Herr Wittstock,
“Ich kann jede Schriftsteller verstehen, der – vor die Wahl zwischen historischer Korrektheit der Fakten und der inneren Logik seines Romans gestellt – sich für den Roman entscheidet und sagt: Fuck the fakts.”
Ich denke, es muss heißen: “Ich kann jeden…” und “facts”.
Viele Grüße!
M. Lauffs
PS. Die Website insgesamt ist sehr gut!
Ohne den Roman schon gelesen zu haben, möchte ich vermuten, dass man zu Mosebachs Gunsten auf die Konvention des anachronistischen Kostüms in der Historienmalerei verweisen kann.
Mosebach könnte, lieber Partick Bahners, auf so mancherlei verweisen. Um sich nicht im Streit um Begriffe zu verlieren hier der Hinweis auf drei andere Romane: Mosebach könnte auf Ransmayrs letzte Welt verweisen, in dem Kaiser Augustus seine Ansprachen in Fußball-Stadien in Bündel von Mikrophonen spricht (eine Technik, die um das Jahr 0 vermutlich noch nicht zur Verfügung stand), oder auf Nadolnys Entdeckung der Langsamkeit, in dem Nadolny John Franklin nicht an Skorbut oder Bleivergiftung sterben lässt, sondern an einem Schlaganfall, oder auf Kehlmanns Vermessung der Welt, in dem Kehlmann ein UFO über den Wassern des Orinoko schweben lässt. Die Laxheit im Umgang mit historischen Tatsachen scheint im postmodernen Roman besonders ausgeprägt zu sein. Ich kann jede Schriftsteller verstehen, der – vor die Wahl zwischen historischer Korrektheit der Fakten und der inneren Logik seines Romans gestellt – sich für den Roman entscheidet und sagt: Fuck the fakts.
Platthaus’ Kritik am Blutbuchenfest leuchtete mir nur dann ein, wenn das im Roman beschriebene halodrihafte Bürger-Milieu nur um 1991 existiert hätte und die Vernetzung durch Smart-Phones und Laptops essentiell wäre für die Beschreibung dieses Milieus. Doch das ist nicht der Fall.
Ihre Replik auf Platthaus ist bestechend einleuchtend und dabei trotzdem fair. Warum man immer auf die umstrittene Rolle Martin Mosebachs im Literaturbetrieb hinweist, statt seinen Roman als das zu lesen, was er ist, nämlich eine gute aktuelle fiktionale Geschichte, bleibt mir ein Rätsel. Auch die lobende Rezension von Ijoma Mangold baute erst einen lächerlichen Disput um Martin Mosebach auf, um seinen Roman dann aber als Geniestreich zu loben.
Ob nun Geniestreich oder “nur” ein hervorragender Gegenwartsroman sei dahingestellt, jedenfalls war Ihre Klarstellung richtig und notwendig.
der Roman ist Posse, farce und am Ende Tragödie, in einer so bezwingenden Gefühlsarithmetik, so luziden und ironischen, auf Th-Mann-Höhen tanzenden Beschreibungenm, ein ganz große Wurf – ich glaube auch, das Platthaus das falsche Haar in der Suppe gesucht und eigentlich doch niocht gefunden hat, siehe Wittstock, ein ganz großer Wurf, oder um s mit Ijoma Mangold in derZEIT zu sagen, ein “Geniestreich”
Platthaus ist vermutlich froh, den vermeintlichen Fehler mit dem Handy entdeckt zu haben. So kann er den ganzen Roman in Bausch und Bogen ablehnen – eben weil ihm die (politische) Figur Mosebach nicht passt. Gesinnungskritik.