Nur das Beste über Mara Cassens und Sarah Stricker
Diese Auszeichnung ist schon ziemlich einmalig: 1970 wurde von Mara Cassens der nach ihr benannte “Preis für einen ersten Roman” gestiftet. Inzwischen ist er mit 15.000 Euro dotiert und damit einer der einträglichsten für Debütanten. Von Christoph Hein bis Lukas Bärfuss haben ihn einige inzwischen sehr namhafte Autoren bekommen und konnten – durch diese private Förderung – ihre Arbeit mit etwas geringeren finanziellen Sorgen fortsetzen. Bemerkenswert auch, dass der Preis nicht durch Profis aus dem Literaturbetrieb vergeben wird, sondern durch eine ehrenamtliche Leserjury, die sich aus 15 Mitgliedern des Hamburger Literaturhauses zusammensetzt. Ich wurde gebeten, die Laudatio auf die diesjährige Preisträgerin Sarah Stricker zu halten, was ich gern getan habe, weil ich ihren Roman Fünf Kopeken schon im Herbst mit Vergnügen gelesen hatte. Gestern, am 9. Januar, wurde die Auszeichnung im Hamburger Literaturhaus vergeben, hier meine Laudatio:
Die komische Tragödie des Hauses “Mode-Schneider”
Lob für einen starken Familien-, Liebes- und Berlinroman samt kleiner Schlenker hin zu Leo Tolstoi und Philip Larkin
Einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur, Anna Karenina, beginnt mit dem Satz: „Alle glücklichen Familien ähneln einander; jede unglückliche ist auf ihre Art unglücklich.“
Ich bewundere, mehr noch: ich verehre den Romancier Leo Tolstoi, seine Werke sind ein literarischer Maßstab, aber für diesen Anfangssatz von Anna Karenina verehre ich ihn nicht. Denn ich halte ihn für falsch oder zumindest für reichlich unklar. Zunächst einmal ist es schwer, als Außenstehender zu beurteilen, ob eine Familie zu den glücklichen oder zu den unglücklichen gehört, oder zu jenen, deren Befindlichkeit irgendwo in der himmelweiten Spanne zwischen Glück und Unglück beheimatet ist. Ein Zwischenzustand, der mir weit verbreitet erscheint, der aber in Tolstois apodiktischem Satz gar nicht vorkommt.
Zum anderen glaube ich bei Familien, die ich als glücklich bezeichnen würde, erhebliche Konstruktionsunterschiede feststellen zu können: Mal sind sie aus einer ersten, mal aus einer zweiten Ehe entstanden und manchmal haben sie mit Ehe absolut nichts im Sinn. Mal begegnen sich die Partner auf Augenhöhe, mal scheint zwischen ihnen ein gewisses Machtgefälle zu existieren. Mal haben sie viele Kinder, mal nur eins. Kurz: Diese glücklichen Familien sind sich untereinander nicht sehr ähnlich. Im Gegensatz dazu sind Ursachen für familiäres Unglück keineswegs immer so individuell, wie Tolstois Satz es behauptet. Nein, unter bestimmten gesellschaftlichen Umständen und in bestimmten Zeitphasen scheint es mitunter recht weit verbreitete Unglücksverhältnisse zu geben.
Von einem solchen charakteristischen Unglücksverhältnis erzählt Sarah Stricker in ihrem Roman Fünf Kopeken, den wir heute feiern. Die Grundstruktur ihrer drei Generationen überspannende Familiengeschichte klingt zumal in Deutschland vertraut. Der Großvater war einst Soldat in Hitlers Armee, dann Kriegsgefangener. Bei seiner Heimkehr fand er ein moralisch abgewirtschaftetes, materiell zerstörtes Land vor. Ideale Voraussetzungen für den Heimkehrer, um mit der verinnerlichten soldatischen Disziplin und Organisationskraft nach dem militärischen Misserfolg nun den geschäftlichen Erfolg zu suchen. Der Großvater gehört, formelhaft gesagt, zur Wirtschaftswunder-Generation, sein Leben wird zu einem pausenlosen Gefecht um den ökonomischen Nutzen. Zweifel oder Zögern kennt er nicht, sondern nur den ewigen Imperativ des finanziellen Höher-Schneller-Weiter. „Er ging nicht“, schreibt Sarah Stricker über ihn, „er rannte. Er fuhr nicht, er raste. Er überlegte nicht, er wusste. Vor allem: es besser.“
Und seine Frau, die Großmutter dieser Romanfamilie, hat den Krieg als jugendliches Opfer des Bombenkriegs erlebt. Alles was eben noch verlässlich erschien, alles was ihrem Leben Form und Halt gegeben hatte, sah sie über Nacht in Rauch aufgehen: Ihre Familie, ihre Stadt, ja ihr ganzes Land mitsamt seiner staatlichen Ordnung. Es gab für sie, musste sie lernen, nichts, mit dem sie rechnen, nichts auf das sie bauen konnte. Also wurde, wie Sarah Stricker schreibt, die Angst „die erste und einzige wahre Liebe meiner Großmutter … Alles was danach kam, waren nur Variationen.“
Das ist zweifellos eine unheilvolle Ausgangslage. Doch zu den vertrackten Eigenschaften der Menschennatur gehört, wie gut sie sich einzurichten versteht, selbst wenn alles in Trümmern liegt. Hätte Sarah Stricker es sich literarisch leicht gemacht, hätte sie das weitere Leben dieses vom Krieg geprägten Paares als eine Art permanenten emotionalen Lazarettaufenthalt beschrieben. Aber sie beweist ihre Qualitäten als Erzählerin nicht zuletzt, indem sie zeigt, dass die beiden ihr Leben nicht als Ausnahmezustand, sondern als ihre spezifische Normalität empfinden – und folglich überhaupt keine Hemmungen haben, ihre Werte, Vorstellungen und Ziele, die sie für ebenso normal halten, an ihre Tochter weiterzugeben.
Ihnen fehlt vor allem die Fähigkeit zur Freude, zum Genuss, zum sinnfreien Wohlgefühl. Was vielleicht kein Wunder ist nach dem totalen Zusammenbruch, den sie erlebten. Denn zur echten Hingabe an die Lebenslust gehört wohl auch eine Bereitschaft zum vorübergehenden Kontrollverlust. Aber wer sich einmal so gründlich wie sie dem unkontrollierbaren Chaos eines Kriegs ausgeliefert sah, dem ist der Spaß daran, die Zügel auch nur zeitweise aus der Hand zu legen, möglicherweise für immer vergangen.

Sarah Stricker, geboren 1980 in Speyer, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und lebt seit 2009 in Tel Aviv. Copyright für das Foto: Oliver Favre
Wenn es unter diesen Umständen auch ihre Tochter nicht leicht hat mit der Lust, muss das niemanden überraschen. Von Kindesbeinen an wird von den Eltern ihr Verstand gefeiert und gefördert, ihre Leistungsfähigkeit bejubelt, ihre Hingabe an die Ziele der Familie verherrlicht. Aber alles andere, ihr Körper, ihre Gefühle, ihre Wünsche werden nicht weiter beachtet und sind schließlich auch ihr selbst fremder als das fernste Ausland. Sie erlebt das klassische Drama des begabten Kindes, das Anerkennung nur dann erhält, wenn es die Bedürfnisse seiner Eltern erfüllt, nie aber eine Chance hat, die eigenen Bedürfnisse zu entdecken.
Wodurch nicht zuletzt ihr Liebesleben zum Desaster wird. Denn als sie Arno kennenlernt, einem Mann, der nichts von ihr fordert, sondern ihr seine Zuneigung bedingungslos entgegenbringt, ist sie überrascht, irritiert, ja sogar abgestoßen und kann in ihm nur einen Schwächling sehen. Wogegen sie ihrem Nachbarn Alex sofort verfällt, denn der nimmt sich von ihr rücksichtslos nur das, was er haben will und kümmert sich ansonsten nicht um sie. Damit kommt sie gut zurecht, bei ihm fühlt sie sich sofort Zuhause, denn dieses Verhalten ist sie von Kindesbeinen an gewohnt.
Sarah Stricker hat aus dem, was man im Jargon der Psychologen eine dysfunktionale Familie nennen würde, nicht nur ein temperamentvolles Familienspektakel gemacht, sondern auch eine tieftraurige Liebesgeschichte über ein Mädchen, das Liebe nicht erträgt und einen hinreißendes Porträt der wilden Stadt Berlin um die Jahrtausendwende. Ihr Buch ist ein fabelhaftes Beispiel dafür, dass ein Roman über triste Lebensverhältnisse keineswegs ein trister Roman sein muss, sondern vom Autor auf rasante und rhetorisch pointierte Weise mit gelegentlich sogar komödiantischen Zügen erzählt werden kann.
In den sechziger Jahren produzierte der Hessische Rundfunk eine herrliche Fernsehserie, „Die Firma Hesselbach“, die bis heute bei Kennern einigen Ruhm genießt. Die Firma Mode-Schneider, die von Sarah Strickers Romangroßvater gegründet und schließlich von der Pfalz nach Berlin umgesiedelt wird, hat gelegentlich Hesselbachsche Züge. Wenn Tante Gundl bei dieser Übersiedlung buchstäblich auf der Strecke bleibt, ist das von haarsträubender Komik und Tragik zugleich. Man kann nur bewundern, mit welcher Sicherheit es Sarah Stricker gelingt, Elemente des Volkstheaters mit präziser psychologischer Analyse und einem kritischen Blick auf deutsche Realitäten und Mentalitäten zur Zeit der Wiedervereinigung zu verbinden. Es ist ihre Sprache, die ihrer Familiengeschichte alle idyllischen, aber auch alle in Schwermut schwelgenden Töne austreibt. Sie erzählt mit Intelligenz und Witz und Verve und mit einem gnadenlosen Biss, mit dem es in meinen Augen in erzähltechnischer Hinsicht eine besondere Bewandtnis hat.
Doch bevor ich auf diesen Punkt eingehe, möchte ich noch ein kleine literarische Reminiszenz einflechten. Denn nicht nur durch den Inhalt von Sarah Strickers Roman, sondern mindestens ebenso so durch seinen Tonfall fühlte ich mich beim Lesen immer wieder an das Gedicht This Be The Verse des großen britischen Lyrikers Philip Larkin erinnert. Es ist gerade zwölf Zeilen lang und hat eine unvergessliche Anfangszeile:
They fuck you up, your mum and dad.
They may not mean to, but they do.
They fill you with the fault they had
And add some extra, just for you.
But they were fucked up in their turn
By fools in old-style hats and coats,
Who half the time were soppy-stern
And half at one another’s throats.
Man hands on misery to man.
It deepens like a coastel shelf.
Get out as early as you can,
And don’t have any kids yourself.

Philip Larkin: "The Complete Poems". Herausgegeben von Archie Burnett. Farrar, Strauss & Giroux. 27, 95 Euro
Larkins Anfangszeile ist bis heute wunderbar provokativ und sie muss in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Larkin sein Gedicht schrieb, noch ein wenig provokativer gewirkt haben also heute, weil er den Mut hatte, eine dem Alltagsslang entlehnte, betont vulgäre Phrase wie „fuck up“ in die noblen Sphären des lyrischen Sprechens und der dichterischen Lebensweisheiten einzuführen.
Auch Sarah Strickers Roman hat einen provokativen Auftakt. Ich habe keine Rezension gelesen, in der die ersten zwei Sätze des Buches nicht zitiert worden wären. Die wollte sich kein Rezensent entgehen lassen. Sie lauten: „Meine Mutter war sehr hässlich. Etwas anderes hätte mein Großvater ihr nie erlaubt.“ Zwei großartige Sätze, und zwar nicht nur weil sie bei Leser von Beginn an jede Schläfrigkeit verscheuchen, da sie offenbar, wie Sarah Stricker in einem Interview sagt, an ein Tabu rühren, nämlich das Tabu, die eigene Mutter öffentlich nicht allzu ruppigen ästhetischen Urteilen zu unterwerfen.
Literarisch großartig ist dieser Auftakt auch, weil hier mit nur zwei Sätzen gleich drei Hauptfiguren des Romans in wesentlichen Punkten gekennzeichnet werden. Im Grunde hat der Leser mit diesen beiden Sätzen das Familiendrama des Romans bereits vor Augen: Nämlich eine Frau, die offenkundig wenig Glück hat im Leben; dazu ihren Vater, der, ohne großes Interesse am Wohlergehen seiner Tochter, unerbittlich Macht über sie ausübt. Und schließlich lassen die zwei Sätze Rückschlüsse zu über jenes Mädchen, von dem die Sätze stammen, Rückschlüsse über die Enkelin des genannten Großvaters: Sie nämlich, so teilt uns schon der Ton der Sätze mit, nimmt für sich in Anspruch, das Familiendrama genau durchschauen und ungeschminkt darüber Auskunft geben zu können.
Wir erfahren im Roman nicht viel über diese Enkelin: Sie ist die Tochter von Arno, jenem demütig liebenden Mann, den ihre Mutter als Schwächling verachtet, sie wurde nach der deutschen Wiedervereinigung geboren und sie ist inzwischen alt genug, ihre ersten beruflichen Schritte als Journalisten zu tun. Ansonsten verrät uns diese Erzählerin kaum etwas über sich. Wir hören von ihr nur, mit welcher Gnadenlosigkeit sie die Fehler der anderen aufspießt, ihre Schwächen offenlegt und über deren lebenslange Unbelehrbarkeit den Kopf schüttelt.
Eine wirklich sympathische Figur ist diese Erzählerin nicht, und ich halte das für einen literarisch höchst gewitzten und geschickten Kunstgriff Sarah Strickers. Denn mit der Bissigkeit ihrer Urteile über Mutter und Großvater, mit ihrer entschiedenen Überzeugung, die Familienmitglieder durchschauen zu können, mit eben dieser Haltung erweist sie sich als perfekte Enkelin ihres Großvaters. Denn so wie sie es ihm nachsagt, kennt sie kein Zweifeln und kein Zögern, so wie er weiß sie nicht nur alles, sondern „vor allem: es besser“.
Eine Pointe dieses Romans über eine unglückliche Familienkonstellation ist also, dass dieses Unglück keineswegs nach zwei Generationen sein Ende findet. „Man hands on misery to man“, sagt Philip Larkin. Auch in der dritten Generation pflanzt es sich fort. Doch diese allmählich milder werdende Stufe des Familienunglücks nicht in der Romanhandlung zur Sprache zu bringen, sondern in der Romansprache deutlich zu machen, also nicht durch das was erzählt wird, sondern dadurch wie erzählt wird, ist eine glänzende literarische Leistung. Ich gratuliere der Jury des Mara-Cassens-Preises zu ihrer Entscheidung, Sarah Stricker diese Auszeichnung zuzusprechen und möchte Sarah Stricker zu dem Preis, aber vor allem zu ihrem beeindruckenden Debüt beglückwünschen.

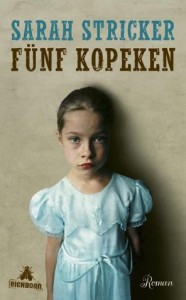
Pingback: Stricker | Nachrichten vom Höllenhund