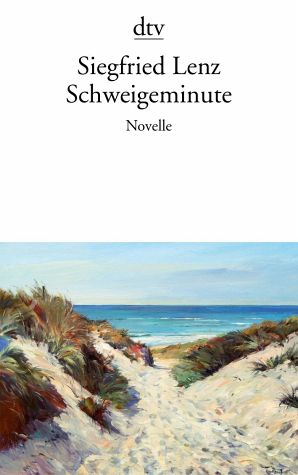“Gelassenheit, Deutlichkeit”
Vor zwei Jahren, am 7. Oktober starb Siegfried Lenz. Er war einer der großen Erzähler der alten Bundesrepublik. Ich traf ihn ein letztes Mal im März 2011 in Hamburg in seiner Wohnung mit direktem Blick auf die Elbe. Es war kurz vor seinem 85. Geburtstag. Damals schrieb ich dieses Porträt über ihn.
Das Erste, was an Siegfried Lenz auffällt, ist die Elbe. Als mächtiges graues Band schiebt sie sich hinter seinem Profil der Nordsee entgegen. Wir treffen uns tief im Westen Hamburgs, direkt am Elbufer, dort, wo der Strom das Labyrinth des Hafens hinter sich gelassen hat, nach getaner Arbeit durchzuatmen scheint und sich zu ganzer Größe streckt.

Siegfried Lenz war zeitlebens zurückhaltend mit biographischen Auskünften. Bis heute gibt es auf dem Buchmarkt nur eine Biografie des Schriftstellers. Erich Maletzke: "Siegfried Lenz. Eine biographische Annäherung". zu Klampen Verlag. eBook. 8,99 Euro
Einladend winkt mich Lenz von Weitem schon an seinen kleinen Tisch. Er steht direkt vor dem Panoramafenster, das den Strom in seiner machtvollen Schönheit zeigt. Es ist, als betrete man ein Kino, in dem nur noch ein zweiter Zuschauer sitzt: der Schattenriss eines schmächtigen Mannes mit großem Kopf und Pfeife vor dem überwältigenden Breitwandpanorama des Flusses.
Ein Auftritt, wie ihn der Erzähler Siegfried Lenz effektvoll und sinnfällig für die Hauptfigur eines Romans erfunden haben könnte. Gleich das erste Bild enthält viel von dem, was den Helden charakterisiert: die Haltung des Beobachters, die Ruhe des Pfeifenrauchers und sein Blick auf den unaufhaltsam vorandrängenden Strom der Ereignisse.
Lenz ist heute, 2011, der dienstälteste Großautor des Landes. Seine erste Geschichte schrieb er 1949, im Gründungsjahr der Bundesrepublik. Es folgten 14 Romane, rund 170 Erzählungen und dazu Essays, Reden, Theaterstücke. In 35 Sprachen wurden seine Bücher übersetzt, 30 Millionen Mal verkauft. Der bescheidene Mann am Elbufer, der fragt, ob er weiterrauchen darf oder ob das stört, ist ein Weltautor, ist Schöpfer und Herr eines literarischen Universums namens Lenz.
Worüber spricht man mit einem Weltautor? Übers Angeln. „Ich bin“, bekennt Lenz, „hoffnungslos in die Fischerei verliebt.“ Wohin auch immer er eingeladen wurde, bat er, sobald die Gastgeber nach seinen Wünschen fragten, um eine Angelrute. In Schottland, in Japan, in Neuseeland konnte er so sein Fischerglück versuchen. „Mein größter Fang? Ein Dorsch in Norwegen. 18 Pfund.“ Nachprüfbare 18 Pfund, sagt Lenz und hebt den Finger. Da ist kein Anglerlatein im Spiel: Die Beute wurde fotografiert, das Bild in einer Zeitung gedruckt.
Sein Lieblingsthema bringt den Erzähler in Schwung: Mit Ulla, seiner zweiten Frau, war er vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal beim Fischen. „Sie ist Dänin und immer dem Wasser nahe gewesen, stammt aber aus einer Försterfamilie und hat nie geangelt.“ Als sie ihren ersten Fisch fing, einen Plötz, haben sie ihn gemeinsam vorsichtig an Land geholt und vom Haken gelöst. „Aber dann hat Ulla ihn nicht nur ins Wasser zurückgesetzt, nein, sie hat ihn vorher noch gestreichelt.“
Mit seiner ersten Frau Liselotte war Lenz 57 Jahre verheiratet. Sie starb 2006. „Danach glaubte ich, es geht nicht mehr weiter. Ich hatte jede Arbeitskraft, jede Imaginationskraft verloren.“ Die Furcht, nie mehr schreiben zu können, war sehr konkret. Er wäre heute, sagt er, ohne seine neue Frau nicht mehr am Leben. „Ulla hat mir enorm geholfen. Sie hat mir insbesondere geholfen, mein Buch zu Ende zu bringen, die ’Schweigeminute’.“
Der Erzähler als Verwandlungskünstler
Mit der Novelle „Schweigeminute“ kehrte Lenz 2008 auf die Bestsellerlisten zurück. Das Buch ist kein blasses Alterswerk, sondern der Triumph eines reifen Schriftstellers, es zeigt Lenz im Vollbesitz seines Könnens.
Er gehörte nie zu den Autoren, die über sich selbst oder das eigene Seelenleben schreiben. Er war immer ein Geschichtenerfinder, der spannende, dramatisch zugespitzte Stoffe liebt. Aber wenn Lenz in „Schweigeminute“ von der Liebe eines gerade Achtzehnjährigen zu seiner Englischlehrerin erzählt, die bei einem Bootsunfall stirbt, dann schimmert doch etwas durch von der Liebe zu seiner ersten Frau, die acht Jahre älter war als er.
Wie jeder große Erzähler ist Lenz letztlich so etwas wie ein Verwandlungskünstler. Was immer ihm begegnet, was immer ihn beschäftigt: Er verwandelt es in eine Geschichte. Und seine Geschichten fangen die spezielle Atmosphäre, das besondere Aroma ihrer Zeit, so präzise ein, dass man beim Lesen glaubt, Kapitel für Kapitel der Vergangenheit der Bundesrepublik wiederzubegegnen.
Er hat eine ungeheure Zärtlichkeit, wenn er Bilder oder Gesten beschreibt, die für dieses Land wichtig sind. Er war gemeinsam mit Günter Grass dabei, als Willy Brandt 1970 auf die Knie fiel vor dem Denkmal für das Warschauer Ghetto. „Der Ort hat Brandt einfach übermannt“, sagt Lenz, „das gibt es: Selbst ein Staatsmann wie Brandt kann übermannt werden.“ Oder er spricht von dem Händedruck, mit dem Helmut Kohl und François Mitterrand 1984 auf dem Soldatenfriedhof von Douaumont die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland bekräftigten.
So sinnlich die Kraft seiner Worte ist, so wenig Wind macht er um seine Person. Seine Wohnung wirkt schlicht, fast ein wenig karg: weiße Wände, wenige Bilder, Möbel, die ihn sicher schon seit Jahrzehnten begleiten. Da ist nichts, was den Welterfolg seiner Bücher verrät – außer dem grandiosen Blick auf die Elbe.

Hanjo Kesting: "Begegnungen mit Siegfried Lenz". Essays, Gespräche, Erinnerungen. Wallstein Verlag. 17,99 Euro
„Schauen Sie, dieses Container-Gebirge!“ Mit der Pfeife in der Hand deutet er auf einen Riesenfrachter, hochbepackt mit Containern, den die Elbe bedächtig an uns vorüberträgt. Lenz war immer ein Schriftsteller des Nordens und der Nautik. Das Wasser zog ihn an, seit er in der kleinen ostpreußischen Stadt Lyck an einem See aufwuchs. „Er bot mir alle Freuden, die ein See bieten kann: schwimmen, tauchen, im Winter Eishockey, angeln.
»Das Alter bringt Gelassenheit, Deutlichkeit«
Er bot ihm aber auch die Schrecken, die im Wasser auf einen warten können. Als Schüler brach Lenz an einem Wintertag durchs Eis. Mit viel Glück nur konnte er gerettet werden. Danach war das Leben wie einen Schritt von ihm zurückgetreten: „Ich hatte streng genommen keine Daseinsberechtigung, ich war überflüssig, entbehrlich, ein fahrlässiger Luxus.“
Vermutlich liegt hier eine Wurzel für die eigentümliche Fähigkeit des Schriftstellers Lenz, von sich selbst abzusehen. „Ich stelle mir vor“ lautet sein Arbeitsprinzip, nicht „Ich habe erlebt“. Auf dem Papier breitet er nicht seine persönlichen Befindlichkeiten aus, sondern erprobt nie gelebte Lebensmodelle. Ihm fehlt die Selbstverliebtheit, jene große Schwäche vieler anderer Autoren. Er ist ein Erzähler, der sich freimachen kann von der eigenen Person und der vielleicht deshalb seinen Lesern oft so nahe kommt.
Die geplanten Feiern zu seinem 85. Geburtstag entlocken ihm nur ein geduldiges Lächeln. Prüfungen nennt er sie, die es zu bestehen gilt. Wichtig ist anderes. Er schreibt an einem neuen Buch, es soll bald fertig werden, wieder eine Novelle. Das Alter bringt, sagt Lenz zwischen zwei Zügen aus der Pfeife, neben vielen Verlusten und „körperlichen Miseren“ auch Gewinne mit sich: „Gelassenheit, Deutlichkeit.“ Und mit aller Deutlichkeit weiß er, dass ihm die Arbeit am meisten bedeutet, nicht das Gefeiertwerden.
Als wolle sie das unterstreichen, trägt die Elbe in aller Ruhe noch ein zweites, diesmal viel kleineres Containerschiff an uns vorüber. Lenz folgt ihm mit den Augen, zuckt die Schultern und meint: „Das macht uns jetzt keinen Eindruck mehr.“
»Herr Lenz, was würden Sie einem jungen Schriftsteller raten, der heute zu schreiben beginnt?«
»Da leihe ich mir einen Ratschlag, den mir der englische Captain Gains kurz nach dem Krieg gab: Wann immer du glaubst, es ist Zeit zu zweifeln, dann sprich es aus«