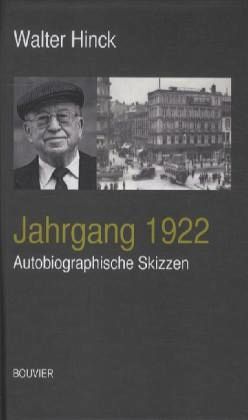Ein Könner ohne Allüren
Ein paar – zugegebenermaßen: voreingenommene – Bemerkungen um Tod des Germanisten und Literaturkritikers Walter Hinck (1922 – 2015). Ich mochte ihn, ich habe viel von ihm gelernt und nicht zuletzt: Er war mein Doktorvater.
Walter Hinck war ein sanfter und kluger Mann. Obwohl er zu den wichtigsten Germanisten Deutschlands zählte, obwohl er über 40 Jahre für die FAZ Literaturkritiken schrieb und also für Schriftsteller viel von seinem Urteil abhing, war ihm jede auftrumpfende Geste fremd.
Nachdem er als 18-Jähriger in Hitlers Krieg hatte ziehen müssen und erst als 28-Jähriger aus der Gefangenschaft zurückkehrte, rückte Hinck die Literatur konsequent in den Mittelpunkt seines Lebens. Dieser Entschluss hatte bei ihm mit Weltflucht nichts zu tun: Literatur war für ihn immer auch ein Seismograf, der viel über die Welt verriet, in der die Schriftsteller lebten. So wurde er zum brillanten Kenner vergangener Epochen. Daneben aber weckte die neue und neueste Literatur schon in den 50er und 60er-Jahren seine Neugier, als viele seiner Universitätskollegen noch kaum über die Goethe-Zeit hinauszudenken wagten. In Göttingen promovierte er 1956 über Bertolt Brecht – also zu einer Zeit, als der Kommunist Brecht im Westen Deutschlands noch alles andere als populär, wenn nicht gar verpönt war. 1964 wurde er Ordinarius an der Universität zu Köln, Ende der siebziger Jahre habe ich an seinem Lehrstuhl gearbeitet. Er war ein angenehmer Chef, ohne die Lehrstuhl-Inhaber-Allüren vieler seiner Kollegen.
Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, hat sich Walter Hinck im akademischen Betrieb nicht immer wohl gefühlt. Er habilitierte sich zwar mit einer komperatistischen Arbeit über das Deutsche Lustspiel des 17. und 18. Jahrhunderts, die allen Forderungen der universtitären Literaturwissenschaft gerecht wurde. Aber – so kam es mir vor – sein Herz hing viel eher an der Gegenwartsliteratur. Er organisierte Lesungen an der Universität oder auch private Begegnungen zwischen Schriftstellern und Studenten. Mein Idee, über zwei damals noch lebende Schriftsteller aus der DDR, Christa Wolf und Franz Fühmann, zu promovieren, konnte ihn folglich nicht schrecken. Er hat mich mit Geduld, enormer Sachkenntnis und viel freundlicher Zuwendung dabei unterstützt.
Als Literaturkritiker pflegte Hinck einen noblen Stil: Er beschrieb in seinen Rezensionen die besprochenen Bücher zunächst sachlich und deutete dann sein Urteil oder gar seine Zweifel an deren Qualität nur behutsam an. Doch wer aufmerksam las, wusste genau, was Hinck von ihnen hielt.
Er war bereits hoch in den Achtzigern als er seine “Autobiographischen Skizzen” veröffentlichte. Ihm gelang, was viele sich vornehmen, aber nur wenige umzusetzen vermögen: Er hat sich in hohem Alter noch einmal ein ganz neues Arbeitsgebiet eröffnet, sich noch einmal neu erfunden. Nach seinen Erinnerungen begann er Erzählungen zu schreiben und konnte mit Zufriedenheit feststellen, dass die beiden Prosa-Bände “Letzte Tage in Berlin” (2011) und “Wenn aus Liebesversen Elegien werden” (2015) viel Anerkennung fanden.
Wenn die deutsche Literaturwissenschaft heute zumindest zu einem nennenswerten Teil in der Gegenwart angekommen ist, dann ist das auch Walter Hincks Verdienst.