Ist es okay, die Putzfrau schwarz zu bezahlen? Und andere ewige Fragen
Expedition in heike Territorien der Literatur: Die Wiener Schriftstellerin Doris Knecht wirft in ihrem Roman Besser einen tiefen Blick ins zeitgenössische Familienseelenleben. Dafür erhielt sie den Buchpreises der Stiftung Ravensburger 2013. Ich wurde gebeten, die Laudatio zu halten, was ich gern getan habe, denn schon Doris Knechts erster Roman Gruber geht (2011) hat mir sehr gut gefallen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Doris Knecht,
Schriftsteller haben es niemals leicht und Autoren von Familienromanen haben es schwer. Denn sie schreiben für ein Experten-Publikum. Fast alle Menschen sind in Familien aufgewachsen, mögen es große Familien gewesen sein oder kleine, und viele von ihnen haben selbst Familien gegründet, kleine oder große, glückliche oder nicht so glückliche, kurz gesagt: Fast alle Menschen haben die Tiefs und Hochs des Familienlebens am eigenen Leib erfahren. Das stellt besondere Anforderungen an den Schriftsteller, wenn er mit dem, was er über Familie erzählen möchte, glaubwürdig bleiben, Klischees umschiffen und die einzige literarische Todsünde vermeiden will, die es gibt, nämlich: seine Leser zu langweilen.
Andere Themen bringen da größere literarische Spielräume mit sich: Ich bewundere Hemingway für das, was er über Großwildjagd schrieb, aber – um ehrlich zu sein – ich habe von Großwildjagd keinen blassen Schimmer. Ein so suggestiver Autor wie Hemingway kann mir da viel erzählen. Ebenso bin ich ein großer Verehrer des jungen John le Carré, doch ob es in der Welt der Geheimdienste tatsächlich so zuging, wie dieser Meister des Spionageromans es darstellte, kann ich nicht überprüfen. Die jüngere deutschsprachige Literatur hält für ihre Leser erstaunlich vielen Polar-Expeditionen, Himalaya-Besteigungen oder Aufenthalte in psychiatrischen Anstalten bereit. Viele dieser Bücher habe ich mit Vergnügen und Neugier gelesen. Doch ob und in wie weit das, was ich da las, seinen Ursprung in dichterischer Freiheit oder sorgfältiger Recherche, in Erfindung oder Erfahrungen hatte, bleibt für mich weitgehend im Dunkeln.
Doris Knecht hat wenig übrig für Themen wie diese. Die Jagd auf Großwild, auf Spione oder 8000-Gipfel reizt sie augenscheinlich nicht. Sie hält sich – zumindest in ihren ersten beiden Romanen – an klassische Themen des psychologischen Romans. In „Gruber geht“, ihrem Debüt, erzählt sie von Krankheit und von Liebe und davon, welchen Umgang zwei Menschen mit diesen Grunderfahrungen des Lebens pflegen, die geprägt sind durch die Moden, Marotten und Ideen unserer Gegenwart. In Besser, dem Roman, den es hier zu feiern gilt, beschreibt sie Zweifel am traditionellen Familienleben, die mir eng mit diesem Geist unserer Zeit und einem bestimmten kulturellen Milieu verknüpft zu sein scheinen, mit Leuten, die unverkennbar im Hier und Heute beheimatet sind, im deutschsprachigen Raum der Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts.
Das ist alles andere als leicht und birgt für den Schriftsteller erhebliche Risiken. Ich weiß nicht, wie sich Jäger unterhalten, die gerade irgendeinem Großwild den Garaus gemacht oder Bergsteiger, die ihr Biwak an einer vermutlich recht zugigen Hochgebirgswand aufgeschlagen haben. Aber die Tonlage, in der die unbürgerlichen Bürgersleut unserer Epoche miteinander reden, kenne ich haargenau. Ich weiß, wie man in diesem Milieu über Kindererziehung spricht oder über Seitensprünge, über einen Karriereknick oder die ewige Frage, ob es okay ist, die Putzfrau schwarz zu bezahlen. Denn dieses Milieu ist mein Milieu. Und das Milieu vieler Hunderttausender anderer Zeitgenossen und Bücherleser. Es kann heute und hierzulande besichtigt werden: im Restaurant am Nebentisch, wo zwei Paare vom jüngsten Urlaub schwärmen, im Büro, wo Kollegen vorm nächsten Meeting noch ein paar Bemerkungen über die neue Staffel von „Homeland“ austauschen oder auf Straßenfesten, bei gymnasialen Elternsprechtagen, in Fitness-Clubs oder diesem netten neuen Bio-Supermarkt in der Nachbarschaft.
Wehe dem Schriftsteller, der über solche ganz und gar vertrauten und landläufigen Lebensformen schreibt, und den Tonfall nicht zu hundert Prozent trifft. Wehe dem, der uns literarisch zu porträtieren versucht und dem dabei auch nur ein Strich um eine Winzigkeit verrutscht. Er wird gnadenlos gerichtet, denn jeder Fehler fällt so gnadenlos auf wie der Pfiff mit einer Trillerpfeife während eines Kammerkonzerts.
Also stürzt sich jeder Autor, der einen zeitgenössischen bürgerlichen Familienroman schreibt, in haarsträubende literarische Gefahren. Denn er oder sie schreibt zwangsläufig für Experten im doppelten Sinne, in Familien- und Milieufragen, für Fachleute, denen ureigene lebenslange Erfahrungen das Ohr sensibilisiert, den Blick geschärft und den Verstand hellwach gemacht haben für eben dieses Thema.
Doris Knecht hat sich in das Abenteuer gestürzt und es nicht nur glänzend bestanden, sondern auf ihrer Expedition in jene heiklen Territorien der Literatur eine bemerkenswerte Trophäe erbeutet. Mit ihrem prüfenden Blick ins heutige Familienseelenleben, spürte sie eine spezifische Gefahr für eben jenes Familienleben auf, die in anderen Epochen vielleicht nur schwer vorstellbar gewesen wäre.
Die Hauptfigur und Erzählerin ihres Romans Antonia betrachtet sich, wie sie selbst sagt, als Teil einer glücklichen Familie. Sie hat einen wohlhabenden Mann, der ihr sogar Wünsche von den Augen abliest, von denen sie bezweifelt, sie je gehabt zu haben. Zwei kleine Kinder, die sie über alle Maßen liebt, obwohl deren Trotzphasen sie naturgemäß an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen. Einen Beruf als Künstlerin, der ihr große Freiheiten lässt. Einen Liebhaber für die leidenschaftlichen Momente des Lebens und dazu noch eine Kreditkarte mit großzügig bemessenem Finanzrahmen.
Alles in allem kein übles Arrangement. Wenn Antonia um sich blickt, kann sie wenig entdecken, das einem handfesten Problem ähnlich sieht. Nur wenn sie in sich blickt, entdeckt sie einen wirklich gefährlichen Gegenspieler ihres Glücks: Sich selbst. Sie ist fest davon überzeugt, nicht zu ihrer fabelhaften Familie zu passen, denn sie ist nicht fabelhaft. Sie hat Fehler, ja schlimmer noch, sie hat Vergangenheit: Eine Mutter, die Alkoholikerin war, einen Jugendfreund, der im Gefängnis landete und dazu ein paar Erfahrungen mit Drogen, die sie problemlos hätten das Leben kosten können.
Nein, Antonia ist davon überzeugt, nicht in die perfekte Welt zu gehören, in die sie da durch Heirat hineingeriet, sie ist nicht aufrichtig, sie hat Geheimnisse, sie hat gelegentlich eine schwer bezähmbare Wut auf ihre trotzigen Kinder, ja sie hat sogar einen Liebhaber. All das gibt ihr ein merkwürdiges Gefühl von Unter- und Überlegenheit zur selben Zeit: Sie glaubt die bedrohlich scharfen Kanten der Realität besser zu kennen als die vermeintlich so behütet aufgewachsenen Wohlstandsbürger um sich her. Und zugleich glaubt sie, schlechter zu sein, weil sie Lügen mit sich herumschleppt und niemals so wahrhaftig, so glaubwürdig, so moralisch auftreten kann wie die anderen.
Mit anderen Worten, Antonia fehlt etwas, das heute wie eine Kardinaltugend gehandelt und ungeniert eingefordert wird: Sie ist nicht authentisch, sie ist nie ganz und gar sie selbst. Sie kennt vielmehr den Unterschied zwischen Sein und Schein nur allzu genau, sie spürt den Bruch, der sich durch ihre Existenz zieht, nur allzu deutlich.
Lange Zeit sieht es in Doris Knechts Roman so aus, als würde Antonias glückliche Familie irgendwann scheitern an dieser mangelnden Authentizität Antonias. Doch so leicht hat es sich Doris Knecht nicht gemacht. Zu den klugen Wendungen ihres Romans, die aus dem Roman einem wirklich starken Roman machen, gehören zwei Einsichten Antonias: Nämlich, dass die anderen ebenfalls ihre kleinen oder größeren Geheimnisse, ihre charakterlichen Brüche und gegebenenfalls nebenehelichen Affären haben. Auch sie sind nicht so authentisch, aufrichtig, wahrhaftig, wie sie im ersten Moment scheinen – ja vielleicht gibt es das wahrhaft authentische Leben gar nicht so oft und vielleicht ist es auch gar nicht so beneidenswert, wie uns die Mode einreden will. Zum anderen begreift Antonia, wie widerstandsfähig, wie belastbar und tolerant das Lebenskonzept Familie sein kann. Ist ihr Mann tatsächlich so ahnungslos, wie sie glaubt, oder hat er einfach gelernt, sie mitsamt ihren Schwächen zu akzeptieren?
Doris Knechts Roman ist nicht zuletzt deshalb ein starker Roman, weil die Verhältnisse, die sie in ihrer Geschichte schildert, nie rundum gut sind, dafür aber immerhin ein wenig besser werden – worauf der Romantitel anspielt. Antonia ist nicht gut, ihre Familie auch nicht in jedem einzelnen Punkt und ihr Freundes- und Bekanntenkreis erst recht nicht. Aber sie alle, Antonia, ihre Familie und Freunde haben die Chance, besser zu werden und manchmal bringen sie die Kraft auf, diese Chance tatsächlich zu ergreifen.
Zugegeben, einen heroischen Eindruck macht das nicht. Aber wenn nur Helden oder rundum gute, perfekte Menschen würdig wären, Familien zu gründen und in Familien zu leben, wäre dieses Lebensmodell vermutlich längst verschwunden. Doris Knechts Familienroman zeigt, dass Familie nichts Perfektes sein muss, dass Familienmitglieder nicht authentisch oder fehlerlos sein müssen – und eine Familie dennoch wunderbar funktionieren kann.
Isaiah Berlin, der große Ideengeschichtler aus Oxford, hat einmal gesagt, der Mensch sei aus einem krummen Holz geschnitzt, allzu viel Gerades darf man nicht von ihm erwarten. Doris Knecht porträtiert in ihrem Roman ein solches krummes Holz und zeigt, welche erstaunliche Fähigkeit Familie hat, es mit anderen, ebenfalls nicht vollkommen geraden Hölzern zu einem Ganzen zusammenzufügen. Dafür wird sie heute Abend mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet und ich gratuliere ihr sehr herzlich.

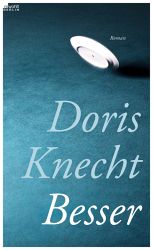

Ich habe “Gruber geht” gelesen und war letztendlich von diesem Roman gefangen, der ein heikles Thema aufgreift.