Gedichte aufsagen beim Appell in Auschwitz-Birkenau
Heute spricht die Schriftstellerin Ruth Klüger anlässlich des Holocaust-Gedenktages vor dem Deutschen Bundestag. Sie war im KZ Theresienstadt, überlebte als Zwölfjährige im KZ Auschwitz-Birkenau. Beschützt und gerettet wurde sie durch Ihre Mutter und manche anonyme Mitgefangene – aber auch durch die Kraft, die sie aus der Literatur zog, aus den Gedichten deutscher Klassiker. Hier eine kleine Skizze einer großen Dichterin – und eine schier unglaubliche Lebensgeschichte:
„Er war ein Dichter und hasste das Ungefähre“, lautet eine der vielzitierten Zeilen von Rainer Maria Rilke. Nicht so oft zitiert wird die Fortsetzung dieses Satzes: „Vielleicht war es ihm nur um die Wahrheit zu tun.“
Ruth Klüger ist eine Dichterin buchstäblich von Kindesbeinen an. Sie war Wienerin und sechs Jahre alt, als die Nationalsozialisten aus Österreich die Ostmark machten. In diesem Augenblick endete die Kindheit Ruth Klügers, denn zur Kindheit gehört doch wohl, dass ein junger Mensch sich behütet und behutsam seine ersten Wege durch die Welt suchen darf.
Doch für Ruth Klüger bestand die Kindheit von nun an nicht aus sacht wachsender Selbstständigkeit, sondern aus rapide wachsenden Einschränkungen und Verlusten. Sie durfte in kein Kino mehr gehen, durfte auf keiner Parkbank mehr sitzen, schließlich keine Schule mehr besuchen. In immer schlechtere, dunklere Wohnungen musste sie umziehen und auf der Straße einen gelben Stern tragen, weshalb selbst Spaziergänge keinen Reiz mehr für sie hatten. Und sie verlor, größter Verlust von allen, ihren Vater. Da war sie neun.
Sentimentalität liegt Ruth Klüger fern. In ihrer Autobiographie schreibt sie nicht, angesichts all dieses Unrechts und dieser Verluste habe sie sich als Kind von der Literatur das Leben verzaubern oder verschönern lassen. Sie schreibt stattdessen: „Man ließ mich lesen, weil ich dann niemanden behelligte.“
Nachdem sie von der Schule ausgesperrt worden war, sah sie monatelang keine Kinder und auch die Familie hatte wenig Zeit. Also vertiefte sie sich in Bücher, las Schiller und andere Klassiker, denn die galten den Erwachsenen als unbedenklich, und da sie ein Talent hatte zum Auswendiglernen, brauchte sie für Schillers Balladen bald kein Buch mehr. Sie sagte sie sogar auf der Straße murmelnd her, was ihre Verwandten für unmanierlich hielten.
Aber als sie dann zwölfjährig im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau bei den Appellen stundenlang in der Sonne stehen musste, hatte sie in diesem lyrischen Gedächtnisvorrat etwas, mit dem sie sich über die Zeit retteten konnte.
Und beim Auswendighersagen blieb es nicht. Schon im ersten KZ, in das man sie und ihre Mutter deportierte, in Theresienstadt schrieb sie eigene Gedichte, und im KZ Christianstadt dann Verse, mit denen sie das Unfassliche, was sie zwischenzeitlich in Auschwitz erlebt hatte, fassbar zu machen versuchte.
Ruth Klüger ist eine Dichterin und hasst das Ungefähre. An beidem lässt ihre Autobiographie keinen Zweifel. Sie nimmt es genau und sie hat die Fähigkeit zur genauen Beobachtung, zu genauen Gedanken, zur genauen Formulierung. Auch und gerade wenn es um ihre Erfahrungen während des Holocaust geht. Sie will, so schreibt sie, sich nicht mit der „Schreckensrührung“ zufrieden geben, in die viele Menschen verfallen, wenn sie von den KZs hören und denen, so schreibt sie „alle Lager in einem Entsetzensnebel verschwimmen, worin man sowieso keine Einzelheiten erkennen kann“.
Ihre Genauigkeit auch in den Einzelheiten ermöglicht Ruth Klüger unerwartete Einsichten. Da sind zum Beispiel die Minuten, in denen sich ihre Rettung aus Auschwitz entschied. Frauen von 15 bis 45 wurden selektiert für einen Arbeitstransport, der Auschwitz verlassen durfte. Ihre Mutter hatte es geschafft, sie war dem Transport zugeteilt worden. Aber Ruth Klüger hatte dem SS-Mann, der die Auswahl traf, die Wahrheit gesagt, sie sei erst zwölf und der verurteilte sie daraufhin mit einem Kopfschütteln zum Tode.
Doch die Mutter überredete die Tochter, sich ein zweites Mal bei einem anderen SS-Mann anzustellen. Und dessen Schreiberin, eine Gefangene wie alle andern, bestärkte Ruth Klüger nicht nur flüsternd darin, ihr Alter diesmal mit 15 anzugeben, sondern überzeugte noch dazu den SS-Mann, diese wenig glaubwürdige Angabe zu akzeptieren.
An einer solchen Szene zeigt sich die Genauigkeit des Nachdenkens und Erzählens von Ruth Klüger. Sie schildert die Szene nicht nur, sie erforscht sie. Es gab für diese Schreiberin nicht den geringsten Grund, sich für sie einzusetzen. Ruth Klüger hatte diese junge Frau noch nie zuvor gesehen und ist ihr auch danach nicht mehr begegnet. Dennoch hat diese Mitgefangene ohne den geringsten Vorteil für sich erwarten zu können, etwas ganz und gar Unerwartbares getan und viel riskiert für eine fremde Zwölfjährige. „Sie sah mich“, schreibt Ruth Klüger, „in der Reihe stehen, ein zum Tod verurteiltes Kind, sie kam auf mich zu, sie gab mir die richtigen Worte ein, und sie hat mich verteidigt und durchgeschleust. Die Gelegenheit zu einer freien, spontanen Tat war nirgends und nie so gegeben wie dort und damals.“
Ein Absatz weiter spitzt Ruth Klüger diese Einsicht noch einmal zu. Die junge Frau hatte nichts zu gewinnen und konnte allzu leicht alles verlieren. Wenn sie sich dennoch gegen jeden Eigennutz für eine Unbekannte einsetze, dann war das eine tatsächlich altruistische, eine tatsächlich freie Entscheidung: „Es kann“, folgert Ruth Klüger, „die äußerste Annäherung an die Freiheit nur in der ödesten Gefangenschaft in der Todesnähe stattfinden, also dort, wo die Entscheidungsmöglichkeit auf fast Null reduziert ist. In dem winzigen Spielraum, der dann noch bleibt, dort, kurz vor Null, ist die Freiheit.“
Solche Sätze haben es in sich. Sie setzen einer anonymen Schreiberin ein Denkmal, die unter unsäglichen Bedingungen menschlich handelte, und sorgen mit ihrer Unerbittlichkeit beim Leser für einen Schock, der in Erinnerung bleibt.
Ruth Klügers Bücher sind voller solcher Sätze. Zum Beispiel, wenn sie nachdenkt über all die literaturkritischen Verbotstafeln, die in den ersten Nachkriegsjahren aufgerichtet wurden, und wenn sie sich dann die hochfahrenden Verbotstafel-Aufsteller wie Adorno zum Beispiel vorknöpft: „Ich meine“, schreibt sie, „die Experten in Sachen Ethik, Literatur und Wirklichkeit, die fordern, man möge über, von und nach Auschwitz keine Gedichte schreiben. Die Forderung muss von solchen stammen, die die gebundene Sprache entbehren konnten, weil sie diese nie gebraucht, verwendet haben, um sich seelisch über Wasser zu halten. Statt zu dichten möge man sich nur informieren, heißt es, also Dokumente lesen und ansehen – und dass gefassten, aber auch betroffenen Mutes. Und was sollen sich Leser und Betrachter solcher Dokumente dabei denken? Gedichte sind eine bestimmte Art von Kritik am Leben und könnten ihnen beim Verstehen helfen. Warum soll man das nicht dürfen? Und“, spitzt Ruth Klüger ihren Widerspruch erneut zu, „was ist das überhaupt für ein Dürfen und Sollen? Ein moralisches, ein religiöses? Welchen Interessen dient es? Wer mischt sich hier ein?“
Ich glaube, es wäre ein Klischee, wollte man Ruth Klüger solcher Sätze wegen eine streitbare Frau nennen. Das klänge ein wenig so, als würde sie Kontroversen suchen, damit unser öffentlicher Debattenbetrieb kräftig brummt und weiterlaufen kann. Nein, treffender ist es wohl, Ruth Klüger eben eine Dichterin zu nennen, die auf Genauigkeit besteht, weil es ihr um die Wahrheit zu tun ist – und die dafür keinem Streit aus dem Weg geht.
Nicht nur, wenn es um ihre Erfahrungen in deutschen KZs geht oder um allzu selbstgewisse Literaturtheorie. Schonungslos ist sie auch sich selbst gegenüber. Wie sie in ihren autobiographischen Büchern die, wie es wörtlich heißt, „blühende gegenseitige Mutter-Tochter-Neurose“ entfaltet, wie sie über die zehn Jahre ihrer frostige Ehe oder über das komplexe Verhältnis zu ihren beiden Söhnen schreibt, ist nie exhibitionistisch oder indiskret, aber doch von einer solchen Schärfe und Klarheit, wie man sie selten findet. Auch das, was die Feministin Ruth Klüger über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen schreibt und mit Alltagsbeobachtungen untermauert, ist von solcher Treffsicherheit, dass man es gerade als Mann nicht leichten Herzens liest.
Oder was sie vom akademischen Betrieb zu erzählen hat: Sechs Jahre lang war sie Ordinaria in Princeton, einer den nobelsten Eliteuniversitäten der amerikanischen Ostküste. Doch was sie mit den ausschließlich männlichen Professoren im German Department dort erlebte, war alles andere als nobel: Die ließen fast keine Gelegenheit aus, ihr das Gefühl zu vermitteln, sie sei dort nur als Quotenfrau geduldet, die an das wissenschaftliche Niveau ihrer männlichen Kollegen nicht heranreiche. Die intensive Beschäftigung mit Kultur, die Ruth Klüger bei diesen Professoren-Kollegen doch wohl voraussetzen durfte, hatte deren Verhalten offenbar nur an der Oberfläche zu kultivieren vermocht. Was darunter zum Vorschein kam, ließ manches von der Behauptung Schillers, die Literatur trage bei zu einer ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts, in einem eher fahlen Licht erscheinen.

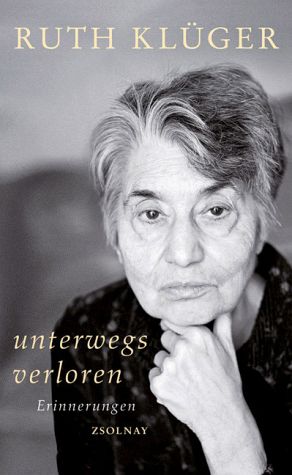


Sehr geehrter Herr Wittstock,
ich lese immer wieder gern Ihre Artikel, zumeist mit großer Zustimmung. Wenn Sie Lust und Zeit haben, können Sie vielleicht den einen oder anderen Text von mir mit Gewinn lesen. Siehe meine Website. Eine Rezension von mir betrifft Ihr Buch “Die Büchersäufer”.
Mit besten Grüßen
Manfred Lauffs
Sehr geehrter Herr Lauffs, vielen Dank für Ihr Lob und die schöne Rezension. Das hat mich sehr gefreut. Herzlich Uwe Wittstock